Von Jakob Maria Mierscheid
„Es ist leichter, ein autoritäres Regime zu Fall zu bringen, als ein liberales System vor seiner eigenen Zerrüttung zu bewahren. Das eine ist künstlich, starr wie ein Kristall und kann nur gebrochen werden. Das andere ist organisch und kann nur absterben.“ (Botho Strauß)
I. Der Staat des Grundgesetzes – ein Instrument der Repression?
Zum Wesen des Ressentiments gehört das Gefühl der sich selbst erhaltenden und selbst bestätigenden Bitterkeit. Das Ressentiment ist gegenüber den dem eigenen Weltbild widerstrebenden Eindrücken resistent, man könnte sagen „erfahrungsgepanzert.“ So zeichnen zwei vorangegangene Beiträge ein düsteres Bild von der Sach-und Rechtslage im laufenden Compact-Verfahren. Nicht nur werde das Verbot Bestand haben, sondern auch der erfolgreiche Eilantrag sei ein bloß retardierendes Moment vor der endgültigen Niederlage, das allein dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – dem letzten Feigenblatt der rechtsstaatlichen Großsimulation – geschuldet sei. Erprobte Repressionsveteranen ließen sich nämlich von solchen Zwischenerfolgen nicht täuschen. So steht das Urteil auf beiden Seiten schon fest: Compact bleibt verboten, die Unterdrückung rechter Strömungen wird zunehmen, denn die Bundesrepublik ist ein repressiver Staat, seine Gerichte und Behörden korrumpiert und zu allem bereit. Das laufende Compactverfahren wird zum Anlass einer grundsätzlichen Systemkritik genommen. Aus den Fängen dieser repressiven Legalität weist der Autor unter Berufung auf Carl Schmitt nur einen Ausweg: die Legitimität des ersehnten Aufstandes. So wird aus dem Juristen Schmitt, einem Theoretiker der Einhegung des Bürgerkrieges und Vertreter des staatszentrierten Ius Publicum Europaeum ein Art Theodor Körner aller nationalen Zeloten. Nun mag die Bundesrepublik in der Tat nicht das Ergebnis einer politischen Entscheidung, sondern das Produkt einer Lage sein (Forsthoff dixit). An ihrem Anfang stand nicht das Pathos einer nationalen Bewegung, sondern die militärische Niederlage des Zweiten Weltkrieges mit ihren bekannten politischen Folgen.
 Ein altbekannter Vorwurf
Ein altbekannter Vorwurf
Von Anfang an sah sich diese Verfassung dem Vorwurf ausgesetzt, von einem Misstrauen gegen das eigene Volk geprägt zu sein. Bemängelt wurden nicht nur die Instrumente des negativen Verfassungsschutzes in Artt. 9 II, 18, 21 II, (später IV) GG, sondern auch die mangelnde plebiszitäre Einbindung des Volkes in den Prozess der Staatswillensbildung. Was vermutlich nur Wenigen bekannt sein dürfte, ist die Tatsache, dass es der Abgeordnete Renner (KPD) im Parlamentarischen Rat war, der dem sich ablehnend zur direkten Demokratie äußernden Kollegen Theodor Heuss diesen Vorwurf entgegenhielt und weiter ausführte, dass das Volk trotz seiner hohen rechtlichen Stellung im Grundgesetz tatsächlich blass in seinen Beteiligungsmöglichkeiten bleibe. Diejenigen die mangelnde demokratische Legitimation des Grundgesetzes rügen, eint mit denen, die sich mehr demokratische Beteiligung wünschen, eine idealisierte und überhöhte Vorstellung von Verfassungsentstehung und demokratischer Verfassungswirklichkeit. Verfassungsgebung aber ist historisch immer ein Oktroy. Die bekannten Verfassungen der Moderne, die französische Menschenrechtserklärung, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und auch der die europäische Staatenwelt prägende Westphälische Friede entstanden nicht unter Einbindung aller künftig der Staats-und Rechtsgewalt Unterworfenen. Die Vorstellung von der Linde, unter der sich das Volk gütig und unbestechlich zwecks Entscheidungsfindung versammelt, blieb ein (vulgär)-rousseauistischer Traum, dem gegenwärtig wohl auch die heutzutage als Rechte Bezeichneten einiges abgewinnen können. Ebenso besteht demokratische Verfassungswirklichkeit nicht darin, ständig neue Befragungen des demokratischen Subjektes durchzuführen, also Entscheidungen in Entscheidungen über Entscheidungen aufzulösen, sondern, wie Niklas Luhmann aufzeigte, in der Spaltung der Spitze in Regierung und Opposition durch den Zeitunterschied von Wahlen.
Die konsequente Konstitutionalisierung des Volkes im Grundgesetz
Rechtsdogmatisch verhält es sich hingegen so: das Grundgesetz setzt den pouvoir constituant in Gestalt der verfassungsgebenden Gewalt des deutschen Volkes überpositiv voraus. Sein Einfluss auf die Staatswillensbildung ist abschließend geregelt. Vorrang hat das repräsentativ demokratische Element gegenüber dem plebiszitären. Eine Volksabstimmung ist gesetzlich nur bei einer Neuregelung des Bundes und einer neuen, die alte ablösenden Verfassungsgebung iSv Art. 146 GG vorgesehen. Zu den naturrechtlichen Elementen des grundgesetzlichen Verfassungswerks gehört nicht nur die Unterscheidung von Recht und Gesetz in Art. 20 III GG oder die Schrankentrias des Art. 2 I GG (Beschränkung der Allgemeinen Handlungsfreiheit durch das Sittengesetz), sondern vor allem das in der Präambel und in der Schlussbestimmung des Art. 146 GG zum Ausdruck kommende Prinzip der unteilbaren Volkssouveränität. Diese wird nicht plebiszitär, sondern institutionell gedacht. Das Volk ist aus Sicht des Grundgesetzes zwar der Grund der Verfassung, zu rechtlich-politischer Gestalt erwächst es aber erst über das institutionalisierte Junktim von Staatsgewalt und Staatsvolk. Die Volkssouveränität des Grundgesetzes ist somit im Kern die staatliche Souveränität Deutschlands. Dadurch, dass der Verfassungsgeber die verfassungsgebende Gewalt positiviert hat, ergibt sich über Art. 79 III GG hinaus eine weitere Schranke der Verfassungsänderung, nämlich der pouvoir constituant constitué (Murswiek) in Form der souveränen Staatlichkeit Deutschlands. Dies ist keine Mindermeinung nationalstaatsfreundlicher Dogmatiker, sondern von der Verfassungsjudikatur anerkannter Grundsatz, der in den Leitentscheidungen zur europäischen Integration den Maßstab bildete. So betont der am Lissabon-Urteil beteiligte Senatsvorsitzende Voßkuhle wiederholt, dass das Grundgesetz die staatliche Souveränität Deutschlands voraussetze, weshalb es dem verfassungsändernden Gesetzgeber nicht gestattet sei, Deutschland in einem europäischen Superstaat aufzulösen. Diese von EU-Enthusiasten als Neo-Etatismus kritisierte Linie hat ihren Grund wiederum in der Unveränderlichkeitsklausel des Art. 79 III GG. Durch diesen entzog der Verfassungsgeber von vornherein bestimmte Grundentscheidungen wie die Menschenwürdegarantie, das Demokratie-und Rechtsstaatsprinzip der Änderung. Eine Totalrevision des Grundgesetzes ist aus Sicht der Verfassung nicht möglich.
 Entscheidung zur wehrhaften Demokratie
Entscheidung zur wehrhaften Demokratie
Der jeder Änderung entzogene Verfassungskern bildet fürderhin den Anker für das Konzept der sog. wehrhaften Demokratie. Ob dieses ein neues Konzept aufgrund der Erfahrungen der Weimarer Republik, oder eine Positivierung von Schmitts positivem Verfassungsbegriff ist, wonach eine Verfassung über ihre Normen hinaus eine Grundentscheidung über Art und Form der politischen Existenz des Volkes enthält, braucht an dieser Stelle nicht entschieden zu werden. Fest steht jedenfalls, dass die absolute Schranke der Verfassungsänderung (Art. 79 III GG) die wesentliche konstruktive Stütze für das Konzept des Verfassungsschutzes bildet. Dieses gliedert sich auf in einen positiven Verfassungsschutz, der die Rechtsgenossen nicht zur Verfassungstreue zwingt, sondern eine positive Erwartungshaltung zur Bejahung der bestehenden Staatsordnung stabilisiert, und einen negativen Verfassungsschutz, der mit den Instrumentarien der Verfassungsschutzbeobachtung und des Partei-und Vereinsverbots ein mitunter problematisches Gefahrenabwehrrecht bildet. Dieser negative Verfassungsschutz steht meist im Mittelpunkt der Diskussion. Zu seiner strukturellen Ambivalenz gehört, dass der Prozess der demokratischen Meinungsbildung grundsätzlich offen von unten nach oben verlaufen muss. Hoheitliche Eingriffe in die Meinungsbildung laufen daher immer Gefahr in hoheitliche Meinungslenkung umzuschlagen.
Rechtssätze als Wertentscheidungen – zwischen Verfassungsekstase und Verfassungsintrovertierung
Verstärkt wurde diese Ambivalenz durch eine Verfassungsinterpretation, die Verfassungsnormen nicht mehr vor dem Hintergrund des Dualismus von Staat und Gesellschaft auslegt, sondern den Grundrechten seit dem Lüth-Urteil als objektive Wertentscheidungen mittelbare Drittwirkung verlieh. Die daraus hervorgehende Schutzpflichtendogmatik mag bei restriktiver Handhabung überzeugen, denn natürlich gilt es die Grundrechte nicht nur als Abwehrrechte gegen den Staat zu verteidigen, sondern auch gegen die Verletzung Privater zu schützen. Doch birgt dies die Gefahr, die Verfassung von einer Selbstverpflichtung des Staates in einen Tugendkatalog für alle umzudeuten, mit der Folge, dass die Grundrechte nicht mehr gegen den Staat gerichtet sind, sondern der Staat umgekehrt die Bürger zur Grundrechtstreue verpflichtet und ebenso wachsam wie argwöhnisch die Gemeinschaft der Verfassungsgläubigen betreut. Ausgelegt werden dabei Verfassungsnormen weniger als Rechtssätze, denen man mit den klassischen canones begegnet, sondern als weltanschauliches Totalprogramm, dem alle zu dienen aufgerufen sind. Theoretische Unterscheidungen wie die zwischen Staat und Gesellschaft, Staat und Bürger verschleifen im Dickicht eines Verfassungserlebnisses, das Abwehrrechte, Schutzpflichten und Leistungsrechte nicht mehr konturieren kann. Die ohnehin der unmittelbaren juristischen Subsumption schwer zugänglichen verfassungsrechtlichen Begriffe wie etwa Menschenwürde. Demokratie, Rechtsstaat, Gleichbehandlungsgrundsatz schrumpfen zur Phraseologie von „unserer Demokratie“, die es gegen ihre finsteren Feinde zu verteidigen gelte. Die sicherheitsgarantierenden und freiheitsverbürgenden Strukturelemente des Staates geraten in den Sog einer Verfassungsideologie, die das eigene Parteiprogramm in der Verfassung verwirklichen will wie auch die Verfassung nicht als Rahmenordnung jenseits wechselnder Mehrheiten, sondern als Protoverwirklichung eigener Partikularinteressen sieht. Der Slogan: „Mehr Demokratie wagen“ widerspiegelt diese Tendenz. Die von Forsthoff bemängelte mangelnde politische Substanz der Bundesrepublik rächt sich nun in Form einer „demokratistischen“ Dauermobilmachung. Das Grundgesetz befindet sich also wie jede Verfassung „auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts“ wie es im Briefwechsel zwischen Smend und Schmitt heißt. Wohin dieser Straßenverlauf führen wird, ist – insoweit pflichte ich dem Autor der vorangegangenen Beiträge bei – Ergebnis künftiger politischer Auseinandersetzungen.
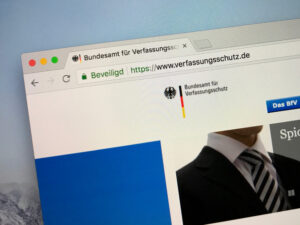 Ist der Staat des Grundgesetzes also von vornherein als Repressionsapparat zu beschreiben?
Ist der Staat des Grundgesetzes also von vornherein als Repressionsapparat zu beschreiben?
Die Antwort darauf muss differenziert ausfallen. Das GG enthält strukturelle Kompromisse, die es um seiner selbst willen nicht politisch, sondern nur normativ auflösen kann. Dazu gehört die starke Stellung der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes als unverbrüchliche Kompetenznorm jeder Verfassungsgebung; Präambel iVm Art. 146 GG. Diese steht in einem Gegensatz zum tatsächlichen Prozess der Verfassungsentstehung im Parlamentarische Rat. Normativ aufgelöst wird dieser Gegensatz über die Schlussbestimmung des Art. 146 GG, der dem Volke die endgültige Entscheidung über Art und Form seiner Existenz überlässt. Darüber wie diese aussehen mag, hüllt sich die Verfassung abgesehen von der tatbestandlichen Voraussetzung der freien Entscheidung des deutschen Volkes in Schweigen. Isensee warnte wohl mit Recht vor den Unwägbarkeiten, die mit dem Durchschreiten des „Feuers des pouvoir constituant“ verbunden sind. Jenen die den grundgesetzlichen Verfassungsstaat mit Verve angreifen, sei die Frage nahegelegt, ob eine neue Verfassung tatsächlich ein „volkskonservativeres“ Profil hätte, oder ob sich diese nicht läse wie ein zeitgeistiges Manifest progressiver Parteiungen. Es muss zumindest zur Kenntnis genommen werden, dass in der Literatur eine ausgefeilte nationalstaatlich orientierte Dogmatik nach wie vor präsent ist, wie sie etwa regelmäßig im Handbuch des Staatsrechts vertreten wird. Kritisch zu bewerten ist die beschriebene Hinwendung zum totalen Verfassungsstaat. Meist begleitet wird diese von einer Lehre, die den Staat in Recht auflösen will. Wo der Staat kein Argument mehr ist (Möllers), beginnt der Weg in die verfassungsintrovertierte Selbstabschaffung. Nicht umsonst greifen viele Gegner der nationalstaatlichen Verfasstheit Deutschlands auf die universalistisch inspirierten Normen des GG –allen voran das unendliche Versprechen der Menschenwürde für alle und für immer – zurück. Diese Verfassungsekstase durchbricht vielfach das grundlegende rechtsstaatliche Verteilungsprinzip, wonach das Handeln des Einzelnen grundsätzlich unbegrenzt, das Handeln des Staates hingegen berechenbar und messbar sein muss. In der Rechtsanwendung gibt die totale Werteordnung den Behörden und Gerichten eine die Grenzen klassischer Auslegung potenziell sprengende Laiendogmatik an die Hand. Der zumindest theoretisch vom Verfassungsgericht immer abgelehnte Gemeinwohlvorbehalt der Grundrechtsausübung droht über die Umdeutung von Recht in Werte und Wertzumessung rechtspraktisch wirksam zu werden. Diese Tyrannei der Werte (Schmitt) im Wege des ständigen Wertvollzugs ist vielleicht der gegenwärtig einzig ernstzunehmende Verfassungsfeind.

II. Das Compact-Verbot als Ausdruck einer marodierenden Werteordnung
Die beschriebene strukturelle Ambivalenz des Verfassungsschutzes gerät seit Jahren in eine bedenkliche Schieflage. So werden nicht nur stets weiter ausufernde Verdachtstatbestände im Verfassungsschutzbericht geschaffen – jüngster Einfall ist die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates – sondern auch die maßstabsbildenden Urteile verkürzt und entstellt wiedergegeben.
Verzerrung der Judikatur durch die Verfassungsschutzbehörden
So ist wesentlicher Anknüpfungspunkt für die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz der Vorwurf, sie vertrete einen ethnischen Volksbegriff. Dabei berufen sich die Verfassungsschutzämter auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im zweiten NPD-Verbotsverfahren. Hierin stellte der Senat die Verfassungswidrigkeit der NPD fest, sah aber auf Rechtsfolgenseite von einem Verbot der Partei ab, da diese kein ausreichendes Gefährdungspotenzial für die freiheitlich demokratische Grundordnung habe. Verfassungsschutzberichte und postnationale Juristen zitieren dieses Urteil gerne, um ihre Auffassung von der Verfassungswidrigkeit des ethnischen Volksbegriffes zu untermauern. Problem ist, dass das Bundesverfassungsgericht dies dergestalt nie behauptet hat, wie ein genauerer Blick in die Entscheidung zeigt. So heißt es bereits im Leitsatz, dass das Grundgesetz keinen ausschließlich (!) an ethnischen Kriterien orientierten Begriff des Volkes kenne. Dies ist vor dem Hintergrund der seit der Reichsgründung auf dem Staatsterritorium befindlichen nationalen Minderheiten kein verfehlter Maßstab. Im Grundsatz geht es darum, dass Staatsvolk und Volk im ethnischen Sinne nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, indem ethnos und demos in Deckungsgleichheit gebracht werden sollen. Es kann vorliegend offenbleiben, ob die damalige Antragsgegnerin NPD tatsächlich eine solche Vollhomogenisierung anstrebte. Festzuhalten ist, dass ein ethnisch exklusiver Volksbegriff nicht bereits dann vorliegt, wenn ein ethnisch-kulturelles Leitbild dem Staatsvolksbegriff zugrunde gelegt wird. Es kommt vielmehr darauf an, welche politischen und juristischen Folgen an das Verständnis des Staatsvolks geknüpft werden. Dem entspricht, dass auch die oberinstanzliche Judikatur die Bewahrung eines relativ ethnisch-homogenen Volkes für sich nicht als verfassungsfeindlich wertet. Das OVG Münster hat in seinem Beschluss zur Verfassungsschutzbeobachtung der AfD zwar die Führung der Antragstellerin als rechtsextremer Verdachtsfall für rechtmäßig erachtet, die Vorinstanz des VG Köln aber dahingehend korrigiert, dass die u.a. von Murswiek vorgezeichnete Unterscheidung von rechtmäßiger Bewahrung der ethnisch-kulturellen Identität und verfassungsfeindlicher Diskriminierung von nicht ethnisch Deutschen der anzuwendende Maßstab ist.
Das zweite NPD-Urteil verabschiedet nicht das Nationalstaatsprinzip
Das zweite NPD-Urteil verwirft ausdrücklich nicht die gefestigte Dogmatik zur rechtlichen Vollidentität und territorialen Teilidentität des Deutschen Reichs mit der Bundesrepublik, ebenso wenig löst es das zur Identitätserhaltung verpflichtende Wahrungsgebot als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Deutschen Volkes ab. Im Gegenteil weist es den Vortrag der Antragsgegnerin, sie strebe lediglich eine Rückkehr zum alten vom ius sanguinis geprägten Staatsbürgerschaftsrecht an als Schutzbehauptung zurück, da die Forderungen der NPD in Wahrheit weit darüber hinaus gingen. Umgekehrt heißt dies, dass die Rückkehr zum alten Staatsbürgerschaftsrecht nicht verfassungswidrig sein kann, da anderenfalls die Bundesrepublik bis zur Reform des Staatbürgerschaftsrecht ein verfassungswidriger Staat gewesen wäre. Beizugeben ist, dass das Urteil einige missverständliche und problematische Formulierungen enthält, die eigentlich einer erneuten verfassungsgerichtlichen Klarstellung bedürften. In diesem Zusammenhang wies Brodkorb jüngst in einem Beitrag für das Magazin Cicero darauf hin, dass der vom Verfassungsschutz vertretene Volksbegriff im Widerspruch zur staatlichen Förderung der ethnisch-kulturellen Identität der Volksdeutschen im Ausland stünde, so dass nur ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen Ausweg aus der dogmatischen Sackgasse weisen würde (Ende Teil 1 des Beitrages).
Hinweis: Der zweite Teil dieser jurististischen Einschätzung findet sich hier!
Beitragsbild / Symbolbild: Bartolomiej Pietrzyk; Bilder oben: Sahara Prince, Matthias Roehe, Jarretera, r.classen / alle Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard
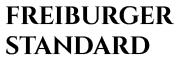




Hinterlassen Sie einen Kommentar