Von Jan Ackermeier
Am Abend des 23. Oktober 1956 füllt sich Budapest mit jungen Menschen. Sie tragen Transparente, rufen Parolen, fordern Reformen. Aus einem Protest wird binnen Stunden eine Bewegung, die das Land erfaßt und die Welt aufhorchen lässt. Ungarn steht seit 1949 unter kommunistischer Parteiherrschaft. Versorgungslage und Zensur belasten den Alltag. Intellektuelle Kreise und Studierende formulieren Forderungen nach politischen und wirtschaftlichen Änderungen. Namen wie Imre Nagy, János Kádár und Ernő Gerő stehen für rivalisierende Linien in diesen Reformbestrebungen.
Die Lage kippt
Am Nachmittag des 23. Oktober ziehen Studenten zur Statue des polnischen Generals József Bem. Sie verlesen die „16 Punkte“: freie Wahlen, Pressefreiheit, Rückzug der Roten Armee. Der Zug wächst, Menschen strömen zum Parlament. „Sowjetische Truppen sollen aus Ungarn abgezogen werden.“ Die Menge jubelt, die Spannung steigt, die Lage kippt. Vor dem Rundfunkgebäude fordern Delegierte der Demonstranten, daß die Forderungen über das Radio gesendet werden sollen. Sicherheitskräfte verweigern die Ausstrahlung. Es fallen Schüsse. In der Stadt brennen Parteizentralen, das riesige Stalin-Denkmal stürzt. Arbeiter schließen sich an, Barrikaden entstehen. Aus einem Marsch wird ein Aufstand, der in Straßenkämpfen in der Hauptstadt mündet.
Die Regierung ruft sowjetische Panzer
Kämpfe breiten sich in mehreren Vierteln aus. Kurz wird ein Ausweg denkbar: Imre Nagy wird wieder Regierungschef und kündigt Reformen an. Anfang November greift die Sowjetunion jedoch mit großer Truppenstärke ein. Der Aufstand wird niedergeschlagen, Tausende sterben, Zehntausende fliehen in den Westen – viele auch nach Österreich. Für Europas Geschichte markiert der Tag einen frühen Bruch im Ostblock. Er verbindet polnische, ungarische und andere Reformimpulse der 1950er Jahre. Wer 1989 verstehen will, blickt auf 1956: Der Sturz des unmenschlichen kommunistischen Systems im Ostblock kam nicht plötzlich, er reifte in vielen kleinen Schritten und wurde mit Mut und vielen Toten erkauft.
Kämpfe breiten sich in mehreren Vierteln aus. Kurz wird ein Ausweg denkbar: Imre Nagy wird wieder Regierungschef und kündigt Reformen an. Anfang November greift die Sowjetunion jedoch mit großer Truppenstärke ein. Der Aufstand wird niedergeschlagen, Tausende sterben, Zehntausende fliehen in den Westen – viele auch nach Österreich. Für Europas Geschichte markiert der Tag einen frühen Bruch im Ostblock. Er verbindet polnische, ungarische und andere Reformimpulse der 1950er Jahre. Wer 1989 verstehen will, blickt auf 1956: Der Sturz des unmenschlichen kommunistischen Systems im Ostblock kam nicht plötzlich, er reifte in vielen kleinen Schritten und wurde mit Mut und vielen Toten erkauft.
Beitragsbild / Symbolbild: Zerstörter sowjetischer T-34 Kampfpanzer am Móricz Zsigmond körtér. Urheber unbekannt.
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard



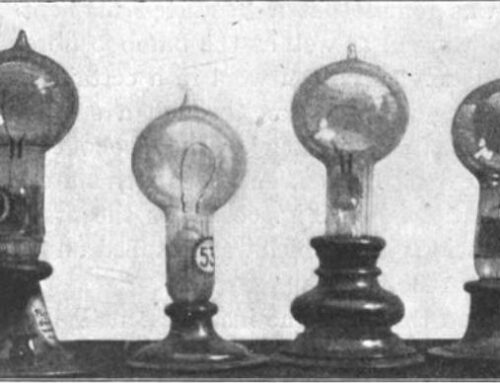

Hinterlassen Sie einen Kommentar