Von Jakob Maria Mierscheid
Auf hoher See wie vor Gericht ist man in Gottes Hand, weiß der Volksmund. Umso erstaunlicher ist es, dass nach der nunmehr zurückgenommenen Hochstufung der AfD zum gesichert rechtsextremen Beobachtungsfall sich zahlreiche Stimmen zu Wort meldeten, die offenbar genau Bescheid wussten, welche Erfolgsaussichten ein Verbotsantrag haben würde. Ebenso wie damit zu rechnen war, dass diejenigen, die schon immer ein Verbot forderten, sich bestätigt sahen und im Verbotsantrag nur mehr eine Formalität sahen, ist es auf der anderen Seite nicht überraschend, dass zahlreiche Verfassungsjuristen, gestützt auf die durchaus vorhandene etatistische, volkskonservative Dogmatik der bundesrepublikanischen Staatsrechtslehre und der Judikatur zur Europäischen Integration das Bemühen um ein Verbot der AfD keine Chancen einräumten.
Immer wieder lawfare
Beide Seiten übersehen tendenziell die politische Dynamik der derzeitigen Lage. Denn der justizpolitische Kampf – im vorangegangenen Beitrag als lawfare benannt – durchzieht gerade alle westlichen liberaldemokratischen Verfassungsstaaten von den USA, über Rumänien bis Frankreich. Zum Wesen des lawfare gehört, dass der Ausgang des Verfahrens nicht gewiss sein kann, da zwar der ordentliche formale Prozessweg beschritten wird, aber die materielle Rechtsfindung neue überraschende Wege geht. So war es nicht absehbar, dass der Angeklagte David Bendels gar nicht aufgrund der verschärften Strafnorm des § 188 StGB, die auch die Beleidigung als Grunddelikt umfasst, sondern der Schuldspruch aufgrund der ebenfalls in der alten Fassung enthaltenen Verleumdung von Politikern erging. Politische Krisenzeiten erschweren die juristische Analyse. Denn ein Blick ins Gesetz oder die Rechtsprechung ist immer ein Blick zurück in die Vergangenheit. Rechtswissenschaft ist insoweit, wie der US-Richter Gary Holmes erkannte, eine Prognose über zukünftiges institutionelles Handeln. Folgender Beitrag beschränkt sich daher darauf, die entscheidenden juristischen Problemkreise zu skizzieren, die mit der verfassungsschutzrechtlichen Auseinandersetzung und einem etwaigen Verbotsantrag einhergehen. Es handelt sich um den Versuch einer rechtspolitischen Risikoanalyse.
 I. Parteiverbot als Ausprägung der wehrhaften Demokratie
I. Parteiverbot als Ausprägung der wehrhaften Demokratie
Das Parteiverbot ist die schärfste Waffe in der Hand der wehrhaften Demokratie. Es folgt aus dem Grundgedanken, dass der Staat einer auch legalen oder gewaltfreien Verfassungsrevision nicht tatenlos zusehen muss. Namentlich geht das Konzept auf die jüdischen Migranten Mannheim und Löwenheim zurück, die vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Machtergreifung eine sog. militant democrazy gegenüber den totalitären Feinden des demokratischen Verfassungsstaates propagierten. So neu war die Idee allerdings nicht, stellt sie doch im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von Carl Schmitts positivem bzw. affrimativen Verfassungsbegriff dar, wonach jede Verfassung über die Verfassungsgesetze hinaus eine politische Grundentscheidung enthalte, die nicht durch einen wertneutralen Legalismus revidiert werden könne.
Der verfassungsrechtlich sanktionierte Parteienstaat
Dabei haben die Parteien im Staat des Grundgesetzes eine hohe Stellung inne. Zwar wirken sie dem Wortlaut des Art. 21 I GG „nur“ an der politischen Willensbildung des Volkes mit, doch entwickelte sich daran anschließend, eine vom frühen Verfassungsrichter Leibholz entwickelte Parteienstaatsdoktrin, die den Parteien die Rolle eines quasi-insitutionellen Scharniers zwischen Staat und Volk beimisst. Parteien sind dieser Doktrin nach Verfassungsorgane. Ein Verbot einer Partei muss daher grundsätzlich an hohe rechtliche Hürden geknüpft sein.
II. Antragsberechtigte und Tatbestandsvoraussetzungen eines Verbots
1. Den Antrag auf Einleitung eines Verbotsverfahrens können Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Der Antrag erfordert im Falle des Bundestages oder des Bundesrates die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ist die Bundesregierung Antragsteller, entscheidet ebenfalls die Mehrheit gem. § 24 II GeschO BReg.
Gemessen an der einschneidenden Rechtsfolge gegenüber einem für die demokratische Legitimationskette tragenden Quasi-Verfassungsorgan sind diese Mehrheitserfordernisse nicht hoch. Diese Mehrheitsregelung ist als solche ein taktischer Vorteil der etablierten Parteien, mithin eine typische Prämie der Superlegalität.
Vorgesehen ist das Parteiverbot in Art. 21 II GG:
Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
Konkretisiert wird dieses anhand der Regelungen der §§ 43 ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Diese sind vor allem für die Rechtsfolgenseite des Verbots bedeutsam.
2. Die materiellen Tatbestandsvoraussetzungen fächern sich in drei Glieder auf:
(1) verfassungsfeindliche Zielsetzung
(2) der Partei anhand ihrer Mitglieder und Anhänger zurechenbare aggressiv-kämpferische Haltung
(3) seit dem NPD-Nichtverbotsurteil aus dem Jahre 2017: Potenzialität, dh Möglichkeit der Beeinträchtigung der Schutzgüter der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Im Falle der AfD sind vor allem die Tatbestandsvoraussetzungen 1 und 2 problematisch, während bei Vorliegen dieser der entscheidende Senat angesichts der Stärke der AfD die Schädigungspotenzialität bejahen dürfte.
Im Einzelnen:
1. Das Kriterium der Verfassungsfeindlichkeit ist nicht schon dann erfüllt, wenn eine Partei nicht mit dem Grundgesetz vereinbare Ziele verfolgt. Denn das Grundgesetz kann mit verfassungsändernder Mehrheit geändert werden. Es geht beim Parteiverbot um jene Verfassungsgüter, ohne die die rechtliche Ordnung der Bundesrepublik nicht mehr freiheitlich wäre.
Seit dem SRP-Urteil wird die freiheitlich demokratische Grundordnung definiert als
„eine Ordnung, die unter Ausschluß jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.“ BVerfG, Urteil vom 23.10.1952 – 1 BvB 1/51
Schutzrichtung des Parteiverbots ist somit der auch in der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 III verklammerte Fundamentalkonsens, der sich aus dem grundgesetzlichen Dreiklang aus Menschenwürdegarantie-Demokratie- Rechtsstaat ergibt. Wie passt dieser restriktive Maßstab in die derzeitige AfD-Verbotsdebatte? Denn weder Programm noch einzelne Funktionäre haben jemals verlauten lassen, Wahlen abschaffen und die Unabhängigkeit der Gerichte untergraben zu wollen.
Die Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder werfen der AfD vor allem die Propagierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs vor. Alle weiteren Vorwürfe der Verletzung der Menschenwürdegarantie oder des Demokratieprinzips schließen sich an den inkriminierten ethnisch-kulturellen Volksbegriff an. So werde aus Sicht des BfV mit der Verwendung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs zugleich die Achtung vor der fundamentalen Rechtsgleichheit nicht-ethnisch deutscher Staatsangehöriger bestritten und diese in der Folge aus dem Staatsvolk ausgegliedert.
Gestützt wird diese Rechtsauffassung auf das zweite NPD-Urteil, in dem der damalige Senat die Verfassungsfeindlichkeit der NPD daran festmachte, dass diese einen ethnisch-exklusiven, rein abstammungsbezogenen Volksbegriff vertrete. Das Konzept einer „blutsmäßig“ vollhomogenisierten Volksgemeinschaft verstieße gegen die Menschenwürdegarantie und das Demokratieprinzips. Im entscheidenden Leitsatz des Urteils heißt es, dass das Grundgesetz einen ausschließlich an ethnischen Kategorien orientierten Volksbegriff nicht kenne.
Dem ist insoweit zu folgen, dass eine politische Partei Volkstum und Staatsvolk nicht gegeneinander ausspielen darf, da in der Folge das demokratische Kollektivsubjekt des Volkes von innen heraus aufgesprengt würde. Auch ist es innerhalb der historischen Auslegung richtig, davon auszugehen, dass das Grundgesetz die Staatsbürgerschaft nicht nur für ethnische Deutsche reserviere, denn immerhin fanden sich unter der deutschen Verfassungsgewalt seit 1871 auch autochthone Minderheiten wie etwa Sorben und Dänen. Problematisch an diesem entscheidenden Judikat ist seine geistesgeschichtlich wenig konturierte, ja laxe Verwendung und Verschleifung der Begriffe Ethnie, Volk, Nation und Rasse. So wird das Abstellen auf den ethnos mit dem biologischen Rassedenken schlechthin identifiziert. Dies ist nicht überzeugend, da Ethnie eben sich nicht allein auf Abstammungsmerkmale stützt, sondern das kumulative Zusammenwirken objektiver Merkmale wie etwa Kultur, Abstammung, Religion, Sitte bezeichnet. So ist bereits der ethnos als rechtspolitische Idee keinesfalls eine biologistische Engführung des Volksbegriffes.
Davon zu unterscheiden sind sog. rassische Konzeptionen, die über Volk und Nation hinaus tatsächliche oder vermeintliche genetische Gemeinsamkeiten zur Grundlage einer biopolitischen Ordnung machen wollen. So erkannte früh bereits Hannah Arendt die revolutionäre Reichweite des nationalsozialistischen Rassedenkens, das letztlich zu einer Zerstörung der konkret vorhandenen Nation führen müsse. Darüber hinaus versäumte es der Senat auf das Verteidigungsargument der Antragsgegnerin NPD einzugehen, sie strebe lediglich eine Rückkehr zum alten, bis 1999 geltenden Staatsangehörigkeitsrecht an. Der Senat begründete dies, dass die Ziele der NPD „in Wahrheit“ (!) weit darüber hinaus gingen.
Selbst wenn man diese Auffassung teilt, ist es verwunderlich, dass in einem dreihundertseitigen Urteil diese entscheidende Abgrenzung zwischen verfassungsfeindlicher biologistischer Vollhomogenisierung und nach alter Fassung des Staatsbürgerschaftsrechts verfassungskonformem Abstellen auf das Abstammungsprinzip nicht vorgenommen wird. In dieses vom Senat geschaffene dogmatische Vakuum fällt die derzeitige rechtspolitische Debatte als ein „Kulturkampf um das Volk“ (Martin Wagener). Die Argumente, die für die affirmative Verwendung des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs sprechen, wurden im Freiburger Standard in zahlreichen Beiträgen elaboriert, beispielsweise hier, hier, hier und hier. Sie sollen daher im Folgenden nur summarisch wiederholt werden:
- Das Grundgesetz gründete keinen westdeutschen Teilstaat, sondern ist die Fortführung des 1871 aus dem Norddeutschen Bund hervorgegangenen Völkerrechtssubjekts des Deutschen Reichs in materieller Voll- und territorialer Teilidentität.
- Das Grundgesetz setzt in der Präambel die verfassungsgebende Gewalt des Volkes (über-)positiv voraus. Mit diesem Bekenntnis zur ungeteilten Volkssouveränität enthält das Grundgesetz nicht etwa eine lose ideologische Legitimationsideologie, sondern eine echte Kompetenznorm, die normative verfassungsrechtliche Bindungskraft entfaltet.
Daraus folgt, dass bereits vor dem Grundgesetz ein deutsches Volk existierte. In seiner ethnisch-kulturellen Zusammensetzung formuliert es das materielle Leitbild des Staatsangehörigkeitsrechts.
- Dem steht auch die Regelung des Art. 116 I Fall 1 nicht entgegen, wonach Deutscher iSd GG der Inhaber der Staatbürgerschaft ist. Denn Fall 2 der Vorschrift bezieht sich ausdrücklich auf die Volkszugehörigkeit als Kriterium der Staatsangehörigkeit. Zudem stellte Art. 116 gerade die rechtliche Kontinuität zwischen dem Staatsvolk des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der Bundesrepublik her. Mit anderen Worten ordnet die Vorschrift an, dass wer im Kaiserreich Deutscher war, es in der Bundesrepublik ebenfalls sein soll. Art. 116 ist somit als Ausprägung der Fortsetzung des Nationalstaates der Deutschen (Präambel) zu sehen.
Zu Recht geht deshalb ein gewichtiger Teil des Schrifttums davon aus, dass Art. 116 I GG nicht nur einen formalen Zurechnungszusammenhang, sondern eine Statusgarantie zwecks Erhaltung des ethnisch-kulturellen Volkes enthalte. Die entgegenstehende Auslegung, wonach Art. 116 I GG dem einfachen Gesetzgeber vollumfänglich die Ausgestaltung der Staatsbürgerschaft überantworte, ist nicht nur Ausdruck eines vulgären Positivismus, sondern führt im Hinblick auf die demokratische Legitimationskette zu einem fragwürdigen Zirkel: so wäre, wenn das Subjekt der Demokratie einfachgesetzlich bestimmbar wäre, der Ursprung der Staatsgewalt immer nur diese selbst. Dies kann man mit der grundgesetzlichen Fundamentalentscheidung zur Fortsetzung des Nationalstaates im Wege der Volkssouveränität und demokratischer Legitimation nicht gemeint sein.
- Die von der Rechtsprechung vorgezeichnete Linie verläuft zwischen verfassungskonformer Bewahrung des ethnisch-kulturellen Volkes und verfassungsfeindlicher Diskriminierung von nicht-ethnisch Deutschen: diese Trennlinie ist scheinklar. Denn weder hält sich die Judikatur an diesen Maßstab – so etwa das VG Köln in seiner Entscheidung zur AfD-Beobachtung – noch legt sie diesen Maßstab günstig aus. So hat das OVG Münster anhand der verfassungsschutzrechtlichen Bewertungen immer wieder die Schwelle zur verfassungsfeindlichen Diskriminierung überschritten gesehen, obgleich eine freiheitsfreundliche Auslegung auch einen verfassungskonformen Inhalt ergeben hätte.
Somit kann die AfD prozessual wenig dagegen tun, wenn Gerichte im Wege ihrer freien Beweiswürdigung – man könnte auch Unterstellung sagen – zu dem Ergebnis kommen, dass AfD-Positionen eine aktive Schlechterstellung von Ausländern mit deutscher Staatsangehörigkeit implizierten. In diesen Zusammenhang gehört die unterschätzte Rolle der Verfassungsschutzberichte.
 Die (heruntergespielte) Bedeutung der Verfassungsschutzberichte
Die (heruntergespielte) Bedeutung der Verfassungsschutzberichte
Viele Verfassungsrechtler wiesen darauf hin, dass die Feststellungen des BfV nicht identisch mit dem gerichtlichen resp. verfassungsrechtlichen Begriff von Verfassungsfeindlichkeit seien. Dies ist dogmatisch und prozessual zutreffend, da alle Gerichte durch die Untersuchungsmaxime dazu verpflichtet sind, sich ein eigenes Bild von der Sach-und Rechtslage zu machen. Dazu gehört sich die Berichte der Verfassungschutzbehörden nicht einfach zu eigen zu machen, sondern einen eigenen und originären verfassungsrechtlichen Maßstab anzulegen. Freilich sind die Dinge vorliegend nicht so klar: so lehnen sich alle Bundes-und Landesverfassungsschutzgesetze an die Definition des SRP-Urteils der fdGO (s.o.) an.
Somit sind auch die einfachgesetzlichen Konkretisierungen des Schutzguts verfassungsrechtlich aufgeladen, mit der Folge, dass zwischen einfachgesetzlichen Wertungen aufgrund der Verfassungsschutzgesetze und dem verfassungsrechtlichen Maßstab zumindest ein Näheverhältnis besteht. Die klare Trennung von einfachgesetzlicher Einschätzung der Sicherheitsbehörden auf der einen Seite und judikativer Beurteilung anhand eigener sachlicher und rechtlicher Erwägungen ist somit bereits dogmatisch durchbrochen. Fürderhin ist Verfassungsschutzrecht der Rechtnatur nach präventives Gefahrenabwehrrecht.
Den Behörden verbleibt somit ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum, der der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle nur begrenzt zugänglich ist. Dies gilt vor allem für die verwaltungsgerichtliche Überprüfung der Verfassungsschutzberichte. Doch auch auf Ebene eines etwaig gestellten Verbotsantrages wirkt sich dies nachteilig aus. Denn wenn über Jahre sämtliche Gerichte der Auffassung sind, dass die Beobachtung der AfD rechtens ist, wird es einem Senat schwer fallen, von einer jahrelang zementierten Rechtsprechung und Beobachtungspraxis abzuweichen.
III. Die Rechtsfolge: das Parteiverbot
Die Rechtsfolge ist zunächst eindeutig geregelt. Sie führt zu einem Verbot der Partei, Einziehung des Vermögens, Mandatsverlust und dem Verbot von Ersatzorganisationen. Doch gibt es auf Rechtsfolgenseite auch die Möglichkeit des Teilverbots. Der Verbotsantrag hat eigentlich einen klar geregelten Antragsgegenstand, nämlich eine vorhandene politische Partei. Nicht umfasst sind Vorfeld- oder Nebenorganisationen. Für sie gilt die abschließende Regelung des Vereinsverbots iSv Art. 9 II GG. Dennoch wurde von verbotsgeneigten Juristen immer wieder erwogen, ob das Verbot sich nicht auf eine Teilorganisation wie etwa die Parteijugend oder einzelne Landesverbände beschränken lasse.
So böte es sich etwa an, den Verbotsantrag auf den thüringischen Landesverband unter Björn Höcke zu beschränken, um sowohl die juristische und politische Akzeptanz für ein Verbot zu erhöhen. Dies Möglichkeit des Teilverbots ist ausdrücklich in § 46 II BVerfGG geregelt. Mit dem Wortlaut von Art 21 II GG, der vom Antragsobjekt der „Parteien“ spricht, ist ein solches Teilverbot nach hier vertretener Auffassung schwer vereinbar. Dennoch ist die Möglichkeit eines Teilverbots nicht nur gesetzlich positiviert, sondern allgemein anerkannt. Die Folge einer solchen Teilzerschlagung der AfD wäre nahezu ebenso verheerend wie ein Totalverbot, weil man, soweit sich das Verbot auf besonders erfolgreiche Landesverbände bezieht, wichtiger „politischer Stützpunkte“ verlustig ginge. Ein Teilverbot hätte den propagandistischen Vorteil, dass man es als besonders ausgewogene, ja schonende Rechtsfolge darstellen könnte, die aber eine zersplitterte und weithin funktionsunfähige AfD hinterließe.
IV. Weitere prozessuale Fallstricke
Vor dem OVG Münster nahm die Diskussion um die Infiltrierung der Partei durch V-Männer einen großen Raum ein. So stellten sich die Prozessvertreter der AfD auf den Standpunkt, dass ebenso wie im Verbotsverfahren vor dem BVerfG das Beobachtungsobjekt staatsfrei sein müsse. Gestützt wurde dies auf den Einstellungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts im ersten NPD-Verbotsverfahren. Damals sah eine Sperrminorität von drei Richtern ein Verfahrenshindernis als gegeben, weil die Antragsteller nicht hinreichend belegen konnten, dass die V-Männer abgezogen wurden. Dieses Argument kann sich auf überzeugende rechtsstaatliche Grundsätze stützen. So wäre ein schwerer Eingriff wie das Parteiverbot kaum zu rechtfertigen, wenn die verfassungsfeindlichen Aktivitäten letztlich dem Staat zuzurechnen sind.
Übersehen wird zweierlei: so ist das BVerfG wie jede Kassationsinstanz nicht an die eigenen Entscheidungen gebunden, zumal es sich gar nicht um eine materielle Entscheidung des Senats handelte, sondern um eine prozessuale, mit der Folge, dass dem sog. Gebot der Staatsfreiheit nicht die materielle Rechtskraft iSv § 31 BVerfGG zukommt. Denkbar wäre somit, dass das Gebot der Staatsfreiheit gegenüber einer konstruierten Gefährdungslage und der staatlichen Verpflichtung zum Schutze der Verfassungsordnung in der Abwägung zurückträte.
 V. Schluss: zur Psychologie des politischen Schauprozesses
V. Schluss: zur Psychologie des politischen Schauprozesses
Es gibt im politischen Prozess keinen Königsweg. In seinen bekannten historischen Erscheinungen vom Prozess gegen Sokrates, Ludwig den XVI, Marie-Antoinette, Moskauer Schauprozesse, Nürnberger Prozesse bis hin zu Eichmann und Klaus Barbie wurden jeweils unterschiedliche Wege der Verteidigung beschritten. Mal schien es erfolgversprechender zu sein, sich gänzlich auf das Formelle zu konzentrieren. So konnte etwa der Verteidiger von Dönitz, Otto Kranzbühler, einen beachtlichen Erfolg für sich verbuchen, indem er sich auf die Dynamik des angelsächsischen Strafprozesses einließ. Jaques Verges, der berüchtigte Anwalt von Pol Pot und Klaus Barbie, wählte meist den Weg der aggressiven Delegitimierung des Prozesses und der politischen Kontextualisierung des Prozessgegenstandes. So parallelisierte er die Besatzungspolitik der Deutschen in Frankreich mit der französischen Kolonialherrschaft.
Eine allzu technische Argumentation läuft jedenfalls immer Gefahr, den Prozessgegner und den Prozessgegenstand zu legitimieren. Ein tragikomisches Beispiel sind die Moskauer Prozesse: So bemühten sich alle Beteiligten darum, das große Missverständnis des in Rede stehenden Klassenverrats aufzuklären, wenngleich die Rechtsfolge in Form der Todesstrafe oder Lagerhaft recht einseitig eine Verfahrensseite belastete. Vorliegend wird in der weiteren verfassungsschutzrechtlichen Auseinandersetzung die Kunst darin liegen, zwischen beiden Polen der Prozessstrategie zu vermitteln.
Beitragsbild / Symbolbild und Bild oben: Corinna Haselmayer; Bild darunter: Cameris; Bild unten: Christin-Klose; Bild ganz unten: DesignRage / alle Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard
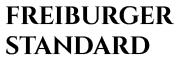




Hinterlassen Sie einen Kommentar