Von Jakob Maria Mierscheid
Das Bürgernetzwerk Ein-Prozent tritt in vielen Fällen mit professioneller und guter Arbeit hervor. Seien es Lageanalysen, die Wahlbeobachterkampagne oder Recherchetätigkeiten, wo Ein-Prozent draufsteht, kann man in der Regel – unabhängig davon, ob man jede politische Ansicht teilt – Qualität erwarten. Mit der Studie „die Angst vor dem Verbot – was der Volksbegriff für die AfD bedeutet“ hat sich die Organisation dagegen keinen Gefallen getan. Der deutliche Qualitätsunterschied zu den sonstigen Veröffentlichungen liegt wohl maßgeblich daran, dass man hier einen externen Autor hat. Die Studie strotzt nur so von Oberflächlichkeiten, Fehlern und einem schwachen, teils nicht verständlichem Aufbau. Dass hier ein (namentlich nicht genannter) „promovierter Jurist“ tätig war und nicht ein Student im ersten Semester will man schon nach den ersten Seiten kaum glauben. Der beste Beweis dafür, dass hier jemand im deutlich höheren Lebenssemester geschrieben hat, ist dabei noch die konsequent verboomerte Sprache und Argumentation. Denn die Fähigkeiten auf dem Gebiet des Verfassungsrechts werden nur von der allgemeinen politischen Analysefähigkeit unterboten, das dafür aber sogar nochmals deutlich.

Buchcover der „Studie“.
Keine Studie
Die Unzulänglichkeiten fangen bereits beim Umschlag an: Um den Volksbegriff geht es, entgegen dem Titel, nur am Rande; Kern ist vielmehr eine versuchte Analyse des zweiten NPD-Verbotsverfahrens und der darauf folgenden Entziehung der Parteienfinanzierung. Dass der Autor einer „Studie“, also einer wissenschaftlichen oder zumindest populärwissenschaftlichen Publikation, ohne Fußnoten und Quellenangaben arbeitet, ist angesichts der zahlreichen anderen Schwächen fast schon nicht weiter erwähnenswert. Dass der Verfasser, von dem keine relevanten politischen Verdienste oder Erfahrungen mit Repression bekannt sind, sich gegenüber verschiedenen politischen Akteuren auch noch deutlich im Ton vergreift beziehungsweise einfach Beleidigungen ohne jede Grundlage austeilt, ist hingegen mehr als nur eine Geschmacksfrage. Der durch die anwaltliche Tätigkeit des Verfassers begründete Anonymität dürfte am Ende effektiv weniger vor Verfassungsschutz und Co., als vor Konsequenzen der Beleidigten schützen. Dass aber der Volksbegriff schlussendlich entgegen dem Titel kaum und die BVerfG-Entscheidung dazu auch noch falsch analysiert wird, ist noch viel schlimmer. Das „Fazit“ setzt dem Ganzen dann noch den Clownshut auf. Doch der Reihe nach:
„Verfassungsidentität“ der Parteien?
Die „Studie“ beginnt mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, der Heimat (früher NPD) die staatliche Parteienfinanzierung zu streichen. Grundlage und Historie wird dabei für den nicht mit der Materie vertrauten Leser schlecht dargestellt, erst sehr viel später erfährt er auf Seite 10, dass die Möglichkeit zur Entziehung der Parteienfinanzierung durch den Gesetzgeber erst nach dem Verbotsverfahren auf Hinweis durch das BVerfG geschaffen wurde. Der fehlende stringente Aufbau ist dabei der einzige rote Faden, der sich durch die Studie zieht, bei der bis zum Ende nicht klar wird, was sie eigentlich behandeln und ausdrücken will.
Nach dieser kurzen Darstellung beginnt der Autor mit der „wehrhaften Demokratie“, ein Konzept, das nach dem Autoren „regelmäßig falsch verstanden“ wird (von wem und wieso, wird nicht aufgeführt, ebenso wenig, was denn korrekterweise darunter verstanden werden muss). Die Parteien nach dem Parteiengesetz gelten laut ihm in der BRD „nach der Staatsfundamentalnorm des Art. 20 Abs. 1 GG als ,verfassungsidentitär´“. Das ist so schon nicht sauber dargestellt. Unabhängig der Diskussion, ob Art. 20 Abs. 1 GG eine „Staatsfundamentalnorm“ darstellt (hinsichtlich einzelner Bezeichnungen dazu finden sich mindestens genauso viele, die Art. 1 GG oder den ganzen Art. 20 GG so betiteln), kommen die Parteien in Art. 20 Abs. 1 GG gar nicht vor. Art. 20 Abs. 1 GG lautet schlicht:
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“
Auch in einzelnen ausgewählten Kommentaren findet man bei Art. 20 GG keine solche Behandlung. Sie ist auch nicht zu erwarten, denn erst in Art. 21 GG kommen die Parteien vor, konkret heißt es in Art. 21 Abs. 1 GG:
„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.“
Die Bezeichnung als „verfassungsidentitär“ ist auch zumindest befremdlich, es ist kein gängiger Rechtsbegriff im Verfassungsrecht, er findet sich weder im GG noch in den beiden besprochenen BVerfG-Urteilen und eine Suche danach findet weder über Google, noch über juristische Portale zu einem Ergebnis. Auch die Suche in mehreren Publikationen zum Staatsorganisations-, Verfassungs- und Parteienrecht (u. a. Detterbeck, Öffentliches Recht; Morlok/Michael, Staatsorganisationrecht, 2023; BeckOK GG/Rux GG Art. 20 Rn. 1-231.1;BeckOK GG/Kluth GG Art. 21 Rn. 1-22; Nomos-BR/Morlok ParteiG/Morlok ParteiG § 1 Rn. 1-7) bleibt ergebnislos. Für solche Fälle wäre es hilfreich gewesen, wenn der Autor Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens eingehalten und eine Quelle angegeben hätte. So muss davon ausgegangen werden, dass es eine eigene Begrifflichkeit des Autors ist (wobei der Anschein erweckt wird, man würde hier mit gesetzlichen Begriffen oder solchen der Rechtsprechung operieren). Die Begrifflichkeit ist dabei schon deshalb abzulehnen, weil eine verfassungswidrige Partei (von der das Grundgesetz explizit spricht) gleichzeitig verfassungsidentitär und verfassungswidrig wäre, was ein erheblicher Widerspruch darstellen würde.
 Rechtsschutz für Parteien – alles Makulatur?
Rechtsschutz für Parteien – alles Makulatur?
Wenn der Autor auf der nächsten Seite behauptet, dass die Rechtswidrigkeit des verweigerten Zugangs zu einer Stadthalle oder die Ablehnung eines Girokontos für eine Partei „in diesen Tagen“ nur noch „Makulatur“ sei, beweist er, dass er offensichtlich nicht mit der Vertretung bei Repressionsprozessen vertraut ist. Bei aller Repression, die es gibt, und bei allem gezielten Unterlaufen des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes durch die Repressionsbehörden, gewinnen politische Oppositionsparteien entsprechende Prozesse dennoch seit Jahrzehnten regelmäßig. Einen entsprechend medienwirksamen Fall gab es erst vor einigen Jahren beim Bundesverfassungsgericht (siehe zum Beispiel hier!) und der Rezensent kann aus gleich mehreren aktuellen, nicht medienwirksamen Verfahren zu genau diesen Bereichen ähnliches berichten. In einer wissenschaftlichen Studie sollten solche pauschalisierten und nicht zutreffenden Stammtischbehauptungen, die zu einer falschen juristischen wie politischen Lageanalyse führen, nichts zu suchen haben.
Was ist eigentlich die FDGO?
Bei der darauf folgenden Darstellung der freiheitlich demokratischen Grundordnung gelingt es dem Autor, nicht zu erwähnen, dass diese von Beginn erst durch die Rechtsprechung des BVerfG überhaupt definiert wurde (konkret im SRP-Verbotsverfahren 1952, BVerfG, Urteil vom 23.10.1952 – 1 BvB 1/51 B ), ebenso gelingt es ihm, die zentralen Normenverbindung von Art. 1, 20 I, II, III und 79 III GG („Ewigkeitsklausel“) nicht zu erwähnen. Würde man damit nicht ohne Fundament im luftleeren Raum operieren, würde man es als löwengleichen Mut zur Lücke bezeichnen müssen. Der Autor drückt es jedoch wie folgt aus:
„Vornweg marschiert ehedem die Menschenwürde (Art. 1 GG), aber auch einiges Weiteres wird dazugezählt, etwa der Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft, die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung sowie der Exekutive und Judikatur an Gesetz und Recht, die Ablösbarkeit der Regierung sowie deren Verantwortlichkeit (!), die Unabhängigkeit der Gerichte (!!) sowie auch das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition (!!!)“ (Anm.: Die Ausrufezeichen sind im Original so gesetzt).
Was sich liest, wie direkt aus der Hölle einer Rentner-Facebookgruppe, ist keine wissenschaftliche Auswertung der bisherigen Rechtsprechung oder verfassungsrechtlichen Literatur, sondern vermutlich das Ergebnis davon, wenn man Chat-GPT befiehlt, Art. 20 I, II, III GG auf empörte Stammtischmanier umzuschreiben. Denn was der Autor beschreibt, ist schlicht Teil des Inhalts des Art 20. I, II, III GG. Die Darstellung der Artikelkette 1, 20 I, II, III, 79 III GG wäre nicht nur juristisch sauberer und für den Erkenntnisgewinn des Lesers zielführender, sondern auch sprachlich schöner.
Von unsauber zu falsch wird es, wenn der Autor direkt danach schreibt:
„Im NPD-Verbotsverfahren hat das BVerfG diesen Gemischtwarenladen jedoch etwas zusammengedampft – übrigens sehr zum Missfallen so mancher interessierten Kreise, die gern bei der verfassungsrechtlichen „Sakralisierung“ eines kunterbunten Allerleis geblieben wären. Nach diesen reduzierten Ansatz wird die FDGO im Wesentlichen konstruiert durch die Würde des Menschen sowie das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG).“
Wer die Rechtsprechung des BVerfG sowie die Artikelkette 1, 20 I, II, III, 79 III GG kennt, weiß, dass das BVerfG hier gar nichts „zusammengedampft“ hat, sondern seit dem SRP-Urteil kontinuierlich dieselbe Auslegung, die bereits in der Gesamtstruktur des GG erkennbar ist, anwendet. Wer Grundlagen verfassungsrechtlicher Definitionen und Subsumtionen kennt, weiß obendrein sogar, dass all das, was der Autor vorher ausführt, genau unter die „zusammengedampften“, von ihm aufgezählten Prinzipien fällt. Dass „das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip“ nicht in Art. 20 GG verankert ist, sondern konkret in Art. 20 I, II, III GG, ist nur eine weitere Unsauberkeit.
Wesensverwandtschaft ist kein Tatbestandsmerkmal
All diese Fehler und Unsauberkeiten finden sich bereits auf den ersten fünf Seiten. In der „Analyse“ der zweiten NPD-Urteils wird es jedoch noch grausiger. Der Autor schreibt:
„Ein wenig überraschend – und für einige schockierend – war die Annahme des BVerfG, die „Wesensverwandschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus reiche für sich genommen für die Anordnung eines Parteiverbotes (noch) nicht aus. Eine solche Wesensverwandschaft weise aber eine ,erhebliche indizielle Bedeutung´ hinsichtlich der Verfolgung verfassungsfeindlicher Ziele auf.“
Das ist abermals unsauber und missverständlich und unvollständig dargestellt. Konkret wurde darauf abgestellt, dass die „Wesensverwandschaft mit dem Nationalsozialismus“ kein Tatbestandsmerkmal des Art. 21 II GG ist:
„Der Ausnahmecharakter der Norm und das Gebot restriktiver Auslegung (vgl. Rn. 523 ff.) schließen aus, die Wesensverwandtschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus als ungeschriebenes, den Anwendungsbereich der Norm erweiterndes Tatbestandsmerkmal anzusehen“, ( BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017, RN. 593)
und:
„Eine vergleichbare Bedeutung kann der Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus hingegen mit Blick auf das Tatbestandsmerkmal des „Darauf Ausgehens“ nicht zuerkannt werden. Dieses ist handlungsbezogen. Hierfür vermag eine Verbundenheit mit nationalsozialistischem Gedankengut grundsätzlich keine Hinweise zu geben.“, BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017, Rn. 598.)
 Wenn man diese Thematik schon anreist, sollte man sie auch sauber darlegen (erst recht in einer juristischen Studie). Der reine Leser der „Studie“ ohne Hintergrundwissen kommt sonst nur zu verwirrenden Schlussfolgerungen oder kann gleich gar nichts damit anfangen. Zwischendurch erheiternd wirkt immerhin, wenn der Autor, der sich sonst nicht um Wissenschaftlichkeit oder Verständlichkeit seines Aufbaus bemüht, das geläufige Wort Potenzial mit „(lat. „potens = mächtig, gewaltig, einflussreich)“ hinterlegt. Leser einer juristischen Studie zu Verfassungsfragen – selbst wenn sie so auf so niedrigem Niveau ist, wie diese hier – darf man für gewöhnlich unterstellen, das Wort „Potenzial“ zu kennen. Neben einigen richtigen Ausführungen zur Entscheidung des BVerfG über das für ein Verbot notwendige Potenzial (was mit dem eigentlichen Thema der Studie gar nichts zu tun hat) und einigen der erwähnten, völlig unnötigen Ausflügen in politischen Betrachtungen, in denen der Autor beweist, dass er von Politik noch viel weniger Ahnung hat als von Verfassungsrecht, kommt das Ende mit Schrecken.
Wenn man diese Thematik schon anreist, sollte man sie auch sauber darlegen (erst recht in einer juristischen Studie). Der reine Leser der „Studie“ ohne Hintergrundwissen kommt sonst nur zu verwirrenden Schlussfolgerungen oder kann gleich gar nichts damit anfangen. Zwischendurch erheiternd wirkt immerhin, wenn der Autor, der sich sonst nicht um Wissenschaftlichkeit oder Verständlichkeit seines Aufbaus bemüht, das geläufige Wort Potenzial mit „(lat. „potens = mächtig, gewaltig, einflussreich)“ hinterlegt. Leser einer juristischen Studie zu Verfassungsfragen – selbst wenn sie so auf so niedrigem Niveau ist, wie diese hier – darf man für gewöhnlich unterstellen, das Wort „Potenzial“ zu kennen. Neben einigen richtigen Ausführungen zur Entscheidung des BVerfG über das für ein Verbot notwendige Potenzial (was mit dem eigentlichen Thema der Studie gar nichts zu tun hat) und einigen der erwähnten, völlig unnötigen Ausflügen in politischen Betrachtungen, in denen der Autor beweist, dass er von Politik noch viel weniger Ahnung hat als von Verfassungsrecht, kommt das Ende mit Schrecken.
Art. 21 III GG ist keine verwaltungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage
Einleitend behauptet der Autor:
„Mit dem jüngsten Urteil haben die Karlsruher Richter gewissermaßen ,abgeräumt´ und der weiteren Repression, wenn einmal die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei festgestellt ist, praktisch einen Freifahrtschein ausgestellt. So ist verfassungsfeindlichen Parteien die grundgesetzlich verbürgte Chancengleichheit der Partien verwehrt. Damit können im parteipolitischen Alltagsgeschäft leichter Stadthallen für Parteiveranstaltungen vorenthalten, Demonstrationen eingeschränkt oder gleich ganz verboten oder offizielle Sendezeiten in öffentlich-rechtlichem Medien versagt werden. Auf die Chancengleichheit können sich laut Verfassungsgericht und angeblich im Sinne des Demokratieprinzips aus Art. 20 GG nur solche Parteien berufen, ,die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten´.“
Das ist schlicht falsch. Schon ein Lesen des entsprechenden Abschnitts aus der Pressemitteilung (denn der Autor zitiert hier, ohne es kenntlich zu machen, die Pressemitteilung zu dem Urteil, nicht das Urteil selbst!) zeigt es:
„Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien aus der staatlichen Finanzierung stellt sich nicht als eine die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG berührende Aushöhlung des Demokratieprinzips dar. Nach dem grundgesetzlichen Konzept der „wehrhaften Demokratie“ können Parteien, die auf die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgehen, gemäß Art. 21 Abs. 2 GG verboten und damit vollständig an der Wahrnehmung des Verfassungsauftrags zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG gehindert werden. Zugleich schließt das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ auch die gleichheitswidrige Benachteiligung solcher Parteien durch den Ausschluss aus der staatlichen Finanzierung ein. […] Die durch Art. 79 Abs. 3 GG garantierte Substanz des Demokratieprinzips wird dadurch nicht tangiert. Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten. Fehlt es daran, stellt der darauf gestützte Ausschluss einer Partei von der Vergabe staatlicher Leistungen keinen Eingriff in den durch Art. 79 Abs. 3 GG garantierten Kerngehalt des Demokratieprinzips dar.“
Man kann dies mit guten Gründen kritisieren. Jedoch äußert sich das BVerfG nur (freilich wenig überraschend) zur Verfassungsmäßigkeit der von ihm vorgeschlagenen und gesetzlichen umgesetzten Streichung der Parteienfinanzierung durch Art. 21 III GG. Dass aber künftig durch die Einführung des Art. 21 III GG zur Entziehung der Parteienfinanzierung Repression in Form einfachen Verwaltungshandeln vereinfacht worden ist, ist schlicht und ergreifend falsch. Keine der vom Autoren behaupteten Repressionsmaßnahmen ist dadurch begründet oder auch nur erleichtert worden. Das zeigt auch die Praxis, die Änderung des Art. 21 III GG spielt bis auf die Streichung der Parteienfinanzierung für die Partei „Die Heimat“ in Repressionsverfahren überhaupt keine Rolle. Eine solche Behauptung ist ein solcher Anfängerfehler in Fragen von Normauslegung, Normhierarchie und Ermächtigungsgrundlagen, dass man sich fragt, wie der Autor überhaupt durch die juristische Zwischenprüfung gekommen sein will.
Ethnischer Volksbegriff und falsche Analyse
Bei der „Analyse“ des Volksbegriffes, also dem vermeintlichen Thema der Studie, geht der Autor ebenso gänzlich fehl. Er schreibt u. a.:
„Im Ausgangspunkt des Bundesverfassungsgerichtes geht es zunächst weniger um ,den´ Volksbegriff von Grundgesetz oder sonstigem Recht und darum, ob es mehrere legitime Volksbegriffe gibt – anders als man zu dieser Frage häufig liest. Der Kniff des Gerichtes besteht viel mehr eher darin, dass es den Begriff des (deutschen) Volkes mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 GG ,auflädt´. Dadurch werde der ethnische Volksbegriff menschenwürdewidrig, weil er nicht hinreichend egalitär sei. Methodisch und axiomatisch unsauber verquickt das BVerfG Menschenwürdegarantie, Volksbegriff und – damit zusammenhängend – das Demokratrieprinzip.“
Auch das ist so nicht richtig. Maßgeblicher Angelpunkt der Urteile in Frage der Menschenwürde ist die jedem Erstsemesterstudenten bekannte Objektformel, wonach es gegen die Menschenwürde verstößt, wenn das Individuum zum bloßen Objekt staatlichen Handelns wird. Den Verstoß gegen die Menschenwürde sieht das BVerfG in der Vorrangstellung des Kollektivs gegen den Einzelnen sowie die Ungleichbehandlung von Menschen, insbesondere deutscher Staatsbürger (denn es geht immer nur um das Staatsvolk des Grundgesetzes), anhand entsprechender ethnischer (und religiöser, rassischer etc.) Kategorien. Das BVerfG formuliert es (unter Nennung der Objektformel, die der Autor nicht einmal aufgreift!) so:
„Auch wenn diese „Objektformel“ in ihrer Leistungskraft begrenzt sein mag (vgl. BVerfGE 109, 279 <312>), ist sie zur Identifizierung von Menschenwürdeverletzungen jedenfalls überall dort geeignet, wo die Subjektqualität des Menschen und der daraus folgende Achtungsanspruch grundsätzlich infrage gestellt werden. Dies ist insbesondere bei jeder Vorstellung eines ursprünglichen und daher unbedingten Vorrangs eines Kollektivs gegenüber dem einzelnen Menschen der Fall. Die Würde des Menschen bleibt nur unangetastet, wenn der Einzelne als grundsätzlich frei, wenngleich stets sozialgebunden, und nicht umgekehrt als grundsätzlich unfrei und einer übergeordneten Instanz unterworfen behandelt wird. Die unbedingte Unterordnung einer Person unter ein Kollektiv, eine Ideologie oder eine Religion stellt eine Missachtung des Wertes dar, der jedem Menschen um seiner selbst willen, kraft seines Personseins zukommt (vgl. BVerfGE 115, 118 <153>; 144, 20 <207 Rn. 540>).
(2) Menschenwürde ist egalitär; sie ist unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, einer behaupteten „Rasse“, Lebensalter oder Geschlecht. Dem Achtungsanspruch des Einzelnen als Person ist die Anerkennung als gleichberechtigtes Mitglied in der rechtlich verfassten Gemeinschaft immanent. Mit der Menschenwürde sind daher ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen nicht vereinbar. Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich – ungeachtet der grundsätzlichen Frage nach dem Menschenwürdegehalt der Grundrechte (vgl. hierzu BVerfGE 107, 275 <284>) – jedenfalls als Konkretisierung der Menschenwürde darstellen. Antisemitische oder auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte sind damit nicht vereinbar und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (vgl. BVerfGE 144, 20 <207 f. Rn. 541>). (BVerfG, Urteil vom 23. Januar 2024,RN. 252.f)
[…]
(1) Im Urteil vom 17. Januar 2017 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das am 4./5. Juni 2010 beschlossene Parteiprogramm unter dem Titel „Arbeit. Familie. Vaterland.“ mit der Garantie der Menschenwürde im Sinne des Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar ist (vgl. BVerfGE 144, 20 <246 ff. Rn. 635 ff.>). Die Antragsgegnerin akzeptiert die Würde des Menschen nicht als obersten und zentralen Wert der Verfassung, sondern bekennt sich zum Vorrang einer ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“. Aus ihrer Sicht ist oberstes Ziel deutscher Politik die Erhaltung des durch Abstammung, Sprache, geschichtliche Erfahrungen und Wertvorstellungen geprägten deutschen Volkes. Anzustreben sei die „Einheit von Volk und Staat“ und die Verhinderung einer „Überfremdung Deutschlands, ob mit oder ohne Einbürgerung“ (vgl. Parteiprogramm der NPD vom 4./5. Juni 2010, 2. Aufl. 2013, S. 11). Deutschland müsse das Land der Deutschen bleiben und dort, wo dies nicht mehr der Fall sei, wieder werden. Grundsätzlich müsse es für Fremde in Deutschland eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat geben (vgl. Parteiprogramm der NPD vom 4./5. Juni 2010, 2. Aufl. 2013, S. 8; siehe auch BVerfGE 144, 20 <247 f. Rn. 639>). Dabei wird auch Eingebürgerten mit Migrationshintergrund kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zugestanden (vgl. Parteiprogramm der NPD vom 4./5. Juni 2010, 2. Aufl. 2013, S. 8, 28 f.; BVerfGE 144, 20 <261 Rn. 681>).
Dieser von der Antragsgegnerin in ihrem Parteiprogramm vertretene Volksbegriff negiert – wie im Urteil vom 17. Januar 2017 dargelegt – den sich aus der Menschenwürde ergebenden Achtungsanspruch der Person und führt zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnischen „Volksgemeinschaft“ angehören (vgl. BVerfGE 144, 20 <247 Rn. 638>). Auf dieser Grundlage zielt das Politikkonzept der Antragsgegnerin auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, Personen jüdischen und muslimischen Glaubens und weiteren gesellschaftlichen Gruppen. Dabei mögen im Urteil vom 17. Januar 2017 aufgeführte einzelne Äußerungen für sich genommen die Grenze der Missachtung der Menschenwürde durch die Antragsgegnerin nicht überschreiten. Die Vielzahl der diffamierenden und die menschliche Würde missachtenden Positionierungen dokumentieren in der Gesamtschau aber, dass es sich nicht um einzelne Entgleisungen, sondern um eine charakteristische Grundtendenz der Antragsgegnerin handelt (vgl. BVerfGE 144, 20 <246 f. Rn. 635>).“ (BVerfG, Urteil vom 23. Januar 2024, RN. 325f)
Nicht „der ethnische Volksbegriff [wird] menschenwürdewidrig“, sondern das Anknüpfen politischen Handelns und Unterscheidungen (vor allem gegenüber deutschen Staatsbürgern) daran. Es geht, um dies nochmal deutlich zu machen, nicht darum, dass man nicht grundsätzlich von einer ethnischen Existenz des deutschen Volkes ausgehen darf, sondern um das Anknüpfen staatlicher Maßnahmen daran und die Unterscheidung zwischen Staatsbürgern anhand von ethnischen Kategorien, die das Individuum nicht als Individuum, sondern als Teil eines Kollektivs werten und ungleich behandeln und damit den Einzelnen in seiner Menschenwürde, so das BVerfG, verletzten. Das BVerfG verwirft zwar an anderer Stelle den ethnischen Volksbegriff als „verfassungsrechtlich unhaltbar“ (BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017,Rn. 690) und führt weiter aus:
„…dass der Bestimmung des „Volkes“ im Sinne des Grundgesetzes ethnischen Zuordnungen keine exkludierende Bedeutung zu. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, ist aus Sicht der Verfassung unabhängig von seiner ethnischen Herkunft Teil des Volkes. Diese verfassungsrechtliche Vorgabe steht in deutlichem Gegensatz zur Auffassung der Antragsgegnerin, nach deren Überzeugung der Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht dazu führt, dass der Eingebürgerte Teil des deutschen Volkes wird.“ (BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017, RN. 691).
Dass das BVerfG hier offensichtlich nicht zwischen zwei verschiedenen Volksbegriffen trennt, ist eine andere Kritik. Es ist aber etwas völlig anderes, den ethnischen Volksbegriff als „verfassungsrechtlich unhaltbar“ zu bewerten oder als „verfassungswidrig“ und als pauschal gegen die Menschenwürde gerichtet. Soweit hier im Rahmen einer Rezension die beiden umfassenden Urteile analysiert werden konnten, ist eine solche explizite Aussage jedoch nicht getroffen worden.
Auch wenn es vielleicht in der politischen Praxis keinen Unterschied macht – denn das Vertreten eines ethnischen Volksbegriffes ohne das Anknüpfen politischer Forderung daran ist politisch sinnlos – muss eine wissenschaftliche Studie zum Volksbegriff (!) eine saubere Subsumtion vornehmen. Dies gelingt nicht einmal im Ansatz. Das (vermutlich) eigentliche Thema des Volksbegriffes des Grundgesetzes wird sodann auf 18, halbseitigen Zeilen dargestellt und schließt mit der Feststellung:
„Was also folgt daraus? Es kommt weniger auf die sophistische, aber viel diskutierte Frage an, ob das Grundgesetz nur einen Volksbegriff oder mehrere kenne oder ob es neben dem ,Staatsvolk´auch ein ,Kulturvolk´gebe. Jedenfalls normativ relevant für das Demokratieprinzip oder die Bestimmung des Demos, ist das deutsche Volk als Gesamtheit der Inhaber der deutschen Staatsangehörigkeit. Damit ist jedoch mit keinem Wort gesagt, dass man nicht auch außerhalb des grundgesetzlich-juristischen Volksbegriffes (politisch) denken und sprechen darf. Ob daneben von einem kulturell imprägnierten Ethnos die Rede sein kann, das seinerseits eine Legitimität aufweisen könnte, dazu schweigen die Richter – können sie auch, weil es sich nicht um eine juristische Kategorie handelt.“
Beim Lesen offenbart sich nicht nur, dass der Autor überhaupt nicht versteht, worum es in dem Urteil eigentlich geht. Vielmehr muss man sich ernsthaft die Frage stellen, wieso der Autor bei dieser Auffassung überhaupt eine juristische Studie mit dem Titel „die Angst vor dem Verbot“ zum Volksbegriff schreiben wollte. Weitere Zitate voller Fehler, Unsauberkeiten und fehlendem Verständnis könnten seitenweise gebracht werden, der Aufwand und die Länge sprengen jedoch bereits jetzt den Rahmen einer üblichen Rezension bei weitem. Daher sei nur noch der Schluss kurz betrachtet. Das politische (nicht juristische) Fazit des Autoren ist sinngemäß: Alles ist gut, die AfD kann nicht verboten werden. Sicherheitshalber soll sie trotzdem aufpassen, nicht zu radikale Sachen zu sagen. Na dann!
 Die gefahrvollen Straßen des öffentlichen Rechts
Die gefahrvollen Straßen des öffentlichen Rechts
Abermals zeigt sich, dass, wer sich auf die „gefahrvollen Straßen des öffentlichen Rechts“ (Smend/Schmitt) begibt, droht, schnell auszurutschen. Der Autor ist dieser Gefahr bereits in den ersten Seiten erlegen, wobei keine Details falsch sind, sondern Grundzüge der rechtlichen Arbeit nicht eingehalten werden und der Autor das Fehlen von Kenntnissen im Verfassungsrecht und teilweise sogar in Grundlagen des öffentlichen Rechts offenbart. Die politischen Betrachtungen und solcher der Repression sind gleich gänzlich ahnungslos. Was der Autor eigentlich bearbeiten will, bleibt unklar, entgegen dem Titel nimmt der Volksbegriff nur wenige Seiten ein und wird kaum in relevanter Weise behandelt. Das „Fazit“ macht eigentlich alle vorherigen Ausführungen überflüssig.
Mit der „Studie“ hat er nicht nur sich selbst keinen Gefallen getan, sondern auch dem Bürgernetzwerk Ein-Prozent nicht. Die sehr sinnvolle und unterstützenswerte Idee einer solchen Studie wurde von der Mannschaft von Ein-Prozent vorbildlich realisiert, abermals fragt man sich, wieso so etwas eigentlich nicht von der Stiftung der AfD oder der Partei selbst realisiert wird. Dafür, dass der Inhalt keinerlei Mehrwert bietet und ganze Abschnitte völlig falsch sind, ist der Autor und nicht Ein-Prozent verantwortlich. Die deutsche Rechte muss abschließend hoffen, dass die bislang von dem Verfasser gewahrte Distanz zur Verteidigung von Repressionsprozessen von ihm weiter eingehalten wird. Hoffentlich wird er in Zukunft dieselbe Distanz auch zur Idee entsprechender Publikationen wahren.
Die „Studie“ ist hier erhältlich bei Ein Prozent.
Beitragsbild / Symbolbild und Bild unter Buchcover: Andres Sonne; Bild darunter: DesignRage; Bild unten: Kim-Kuperkova / alle Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard
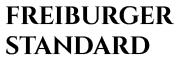




Hinterlassen Sie einen Kommentar