Von Jan Ackermeier
Am 10. April 1998, einem Karfreitag, geschah etwas, das viele kaum mehr für möglich hielten: In Nordirland wurde nach jahrzehntelanger Gewalt ein Friedensvertrag unterzeichnet. Das sogenannte Karfreitagsabkommen setzte einen entscheidenden Schritt in Richtung Versöhnung zwischen verfeindeten Lagern. Nordirland war jahrzehntelang Schauplatz brutaler Auseinandersetzungen. Katholische Republikaner kämpften für eine Vereinigung mit Irland. Protestantische Unionisten wollten Teil des Vereinigten Königreichs bleiben. Über 3.500 Menschen starben, darunter viele Zivilisten. Das Leben war geprägt von Angst, Misstrauen und Haß zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
 Blutige Geschichte – tiefe Gräben
Blutige Geschichte – tiefe Gräben
Doch 1998 rangen sich die Konfliktparteien zu einem historischen Kompromiss durch. Die britische und die irische Regierung sowie die nordirischen Parteien einigten sich auf eine neue politische Ordnung, gemeinsame Institutionen und das Ende der Gewalt. Auch eine umfassende Amnestie für Untergrundkämpfer beider Seiten wurde erlassen. Der Wille zum Frieden war größer als der Wunsch nach Rache. Der Weg zum Frieden blieb und bleibt aber weiterhin steinig. Heute, 27 Jahre später, lebt Nordirland mit den Folgen der Vergangenheit. Der Konflikt in Nordirland ist in seinem Kern bis heute ungelöst. Immer noch gibt es tiefe Gräben zwischen der katholischen und der protestantischen Bevölkerungsgruppe. Positiv ist immerhin, dass sich alle Konfliktparteien auf friedliche politische Wege zu einer Lösung und auf den Verzicht auf Eskalationen verpflichtet haben.
Beitragsbild / Symbolbild: Ein typisches Wandgemälde mit politischen Botschaften. Urheber unbekannt.
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard




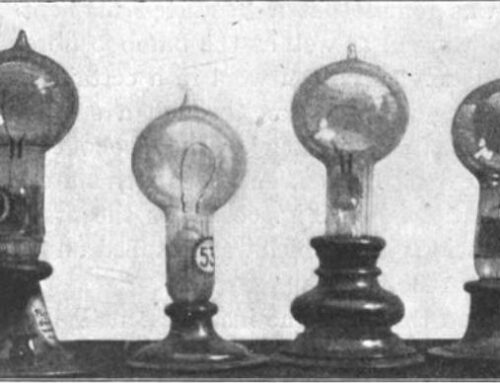
Hinterlassen Sie einen Kommentar