Von Jakob Maria Mierscheid
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Dies besagt das Strafgesetzbuch (StGB) § 339 Rechtsbeugung.
I. Strafgesetzbuch (StGB) § 339 Rechtsbeugung
Der Fall des Weimarer Familienrichters, dessen Revision gegen die Verurteilung wegen Rechtsbeugung (§ 339 StGB) jüngst durch den Bundesgerichtshof verworfen wurde, machte bundesweit Schlagzeilen. Hintergrund war, dass der Angeklagte aufgrund einer von ihm angenommenen Kindeswohlgefährdung die Maskenpflicht für Schüler an zwei Schulen aufhob. Da er das Verfahren nach den Feststellungen des Landgerichts entgegen den Zuständigkeitsverteilungen bewusst an sich zog, um die Maskenpflicht zu beenden, kommt es nach Auffassung des Senats gar nicht darauf an, ob die Entscheidung materiell rechtmäßig war. Mit anderen Worten: der formale Verstoß gegen die Zuständigkeiten indizierte und begründete den Straftatbestand der Rechtsbeugung. Ob die Maskenpflicht rechtens, dh verhältnismäßig war, ist aus Sicht des Bundesgerichtshofs eine – man könnte sagen – sachfremde Erwägung.
Der Beschluss stellt somit maßgeblich darauf ab, dass der Richter planmäßig und ergebnisorientiert ein bestimmtes Urteil fällen wollte. Entscheidend für die Verurteilung – so muss man den Beschluss wohl verstehen – war der subjektive Wille zur angeblichen Rechtsbeugung. Dieser war aus Sicht der Gerichte darin begründet, dass der Angeklagte die formellen Geschäftsverteilungen in eigener Sache manipulierte, indem er ihm bekannte Maßnahmenkritiker zu rechtlichen Schritten gegen die Maskenpflicht riet. Aufgrund der nach Namen geordneten Zuständigkeitsverteilung soll er nach den tatrichterlichen Feststellungen seine Richterstellung ausgenutzt haben.
 Problematisch daran ist, dass der Straftatbestand der Rechtsbeugung in Abgrenzung zur früheren rein subjektiven Rechtsbeugungstheorie nach herrschender Lehre und Rechtsprechung objektiv zu bestimmen ist. Es kommt also darauf an, dass eine materiell fehlerhafte Entscheidung getroffen wurde. Wenn diese zusätzlich nicht nur fehlerhaft, sondern schlechthin unvertretbar und vom subjektiven Willen zur Rechtsbeugung getragen ist, kommt eine Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung in Betracht. Für den Bundesgerichtshof reichte doch allein, dass der Richter entgegen den üblichen Geschäftsverteilungen eine Gelegenheit suchte, eine entsprechende Entscheidung zu fällen.
Problematisch daran ist, dass der Straftatbestand der Rechtsbeugung in Abgrenzung zur früheren rein subjektiven Rechtsbeugungstheorie nach herrschender Lehre und Rechtsprechung objektiv zu bestimmen ist. Es kommt also darauf an, dass eine materiell fehlerhafte Entscheidung getroffen wurde. Wenn diese zusätzlich nicht nur fehlerhaft, sondern schlechthin unvertretbar und vom subjektiven Willen zur Rechtsbeugung getragen ist, kommt eine Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung in Betracht. Für den Bundesgerichtshof reichte doch allein, dass der Richter entgegen den üblichen Geschäftsverteilungen eine Gelegenheit suchte, eine entsprechende Entscheidung zu fällen.
Damit entzog sich der Senat mehr oder minder geschickt den schwierigen Fragen der Verhältnismäßigkeit der Strafe im Hinblick auf die nunmehr deutlich skeptischere juristische und medizinische Bewertung der Corona-Maßnahmen. Denn wenn die Corona-Maßnahmen selbst juristisch fragwürdig waren, muss auch ein Richter, der möglicherweise unter Ausnutzung kompetenzieller Unklarheiten eine maßnahmenbeendende Entscheidung traf, verhältnismäßig anders bestraft werden als ein etwa nur zum eigenen Vorteil handelnder Rechtsbeuger. Man kann davon ausgehen, dass der Senat diese Abwägung nicht durchführen wollte. Tatgericht und Revisionsinstanz zogen sich auf einen formellen, scheinbar unpolitischen Standpunkt zurück.
Freilich steht der politische Hintergrund ebenso unverändert im Raum, wie sich auch die Reaktionen auf das Urteil entlang der politischen Bewertung des Corona-Regimes verteilten. Einmal mehr zeigt sich, dass es unpolitisches Recht nicht gibt. In der rechtsstaatlichen Normallage mag dieser Umstand unauffällig sein und stillschweigend übergangen werden, in Zeiten politischer Eruptionen und Veränderungen tritt er teils gewalttätig hervor. Damit veranlasst der Fall des Weimarer Richters zu grundsätzlichen Reflexionen über das Verhältnis von Macht und Recht.
II. Norm und Entscheidung
Normen wenden sich nicht selbst an. Als abstrakte Regelungen sind sie ebenso bloß abstrakte Gedanken. Sie bedürfen der Auslegung, Anwendung und Durchsetzung. Die Norm gelangt daher nicht als solche, sondern erst im Moment ihrer Anwendung und Durchsetzung zu sozialer Wirklichkeit. Normen sind daher an ihren beiden Enden, ihrer Entstehung wie ihrer Anwendung, nicht dem „Reich der Lüfte“ entsprungen, sondern Entscheidungen mit sozialer und politischer Tragweite. Aus der Warte des dezisionistischen Rechtsdenkens sind sie weder auf Ebene der Normerzeugung noch auf Ebene der Anwendung lückenlos logisch begründbar.
Carl Schmitt sprach von der creatio ex nihilo – der Entscheidung aus dem normativen Nichts. Doch rekurriert die Idee der Herrschaft der Gesetze zugleich auf einen alten Menschheitstraum: nämlich, dass anstelle der Menschen mit ihren Launen, Schwächen und willkürlichen Begehrlichkeiten die Gesetze als materialisiertes Reich der Vernunft herrschen. Von Platons Nomoi, über Kants Formel von der „Vereinigung von Menschen unter Rechtsgesetzen“ und Hegels Staatsenthusiasmus – Staat als Wirklichkeit der sittlichen Idee– bis zu heutigen Rechtsstaatsapologien, bildet die Vorstellung vom „richtigen Recht“ als dem allgemein Vernünftigen und Gerechten den vielleicht wichtigsten Topos abendländischen Staatsdenkens.
Doch so hehr das Recht an sich sein mag, so sehr ist es doch auf die es praktizierenden Menschen angewiesen, um derentwillen es existiert. Ist damit aber das Recht mit der Rechtsanwendung gleichzusetzen? Der US-amerikanische Supreme-Court-Richter Holmes (1841-1935) vertrat hierzu eine berühmt gewordene, pointierte Auffassung:
„The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law.“
Recht und Rechtswissenschaft ist demnach nichts anderes als eine Prognose über institutionelles Handeln. Man mag diese Definition als überspitzt empfinden, doch ist es fast trivial festzustellen, dass Recht, soziale Wirklichkeit und Macht auf die ein oder andere Weise miteinander zusammenhängen.
 In Deutschland ist der Begriff des Rechts und des Rechtsstaats ein (a)politischer Kampfbegriff: apolitisch ist er, weil sich gerne Juristen darauf beschränken, „nur“ das Recht anzuwenden und damit jedweden politischen Zusammenhang bestreiten; politisch ist der Rechtsstaatsbegriff, weil in kaum einem anderen Land dieses Compositum derart wirkmächtig in die politische Debatte eingreift. Kaum etwas wiegt in einer politischen Diskussion schwerer als der Vorwurf, dass ein politisches Vorhaben rechtswidrig sei. Diesen Vorwurf verstärkt die politische Nachkriegskultur des Verfassungspatriotismus. Wenn die Verfassung das Vaterland (Isensee) ist, dann ist der Verfassungsbrecher – horrible dictu – Vaterlandverräter.
In Deutschland ist der Begriff des Rechts und des Rechtsstaats ein (a)politischer Kampfbegriff: apolitisch ist er, weil sich gerne Juristen darauf beschränken, „nur“ das Recht anzuwenden und damit jedweden politischen Zusammenhang bestreiten; politisch ist der Rechtsstaatsbegriff, weil in kaum einem anderen Land dieses Compositum derart wirkmächtig in die politische Debatte eingreift. Kaum etwas wiegt in einer politischen Diskussion schwerer als der Vorwurf, dass ein politisches Vorhaben rechtswidrig sei. Diesen Vorwurf verstärkt die politische Nachkriegskultur des Verfassungspatriotismus. Wenn die Verfassung das Vaterland (Isensee) ist, dann ist der Verfassungsbrecher – horrible dictu – Vaterlandverräter.
Der Begriff des Verfassungspatriotismus leistet somit das Gegenteil, von dem was er verspricht. Sollte die Verfassung als Rahmenordnung des Gemeinwesens die politischen Unterschiede im Staatsvolk gerade neutralisieren, so trägt der Verfassungspatriotismus dazu bei, dass jeder zum „Verfassungsfeind des anderen werden kann“ (Maschke). Es ist daher fragwürdig, ob die Totalisierung der Verfassung zum Weltenei (Fortshoff dixit) der objektiven Werteordnung, mithilfe derer sich auch Sozialhilfesätze berechnen lassen, dem Ansinnen, eine stabile rechtsstaatliche Ordnung zu schaffen, tatsächlich Rechnung trug. Doch zur Tragik des Lernens aus der Geschichte gehört auch, dass man vor falschen Schlüssen nicht gefeit ist.
III. Die richtige Lehre aus der Vergangenheit?
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des NS-Regimes war die Wiederherstellung und Ausgestaltung des Rechtsstaats einer der zentralen, überparteilich angestrebten Aufgaben der jungen Bundesrepublik. Dabei sollte nicht nur an überkommene Staatsrechtstraditionen angeknüpft werden, sondern eine Fort-und Neuentwicklung des formalen Rechtsstaats des 19. Jahrhunderts zum materialen und sozialen Rechtsstaats vorgenommen werden (vgl. hierzu instruktiv Böckenförde, Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs).
Die einsetzende Vergangenheitsbewältigung machte sobald auch vor der Rechtswissenschaft keinen Halt. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei im Jahre 1967 die Habilitation von Bernd Rüthers über Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. Rüthers legt den Schwerpunkt seiner Analyse auf die Rechtsanwendung. Zentrale These ist, dass Verfassungsrevolutionen nicht etwa durch Umstürze, sondern sich in kleinen Schritten über die Rechtsanwendung vollziehen. Dabei erblickt Rüthers den entscheidenden methodischen Wendepunkt nicht in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern in der frühen Judikatur des Reichsgerichts: so konnte der noch im Kaiserreich vorherrschende Positivismus in der Weimarer Republik keinen Bestand haben, da sich die soziökonomischen Grundlagen fundamental geändert hatten. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang die sog. Aufwertungsrechtsprechung des Reichsgerichts vor dem Hintergrund der Hyperinflation. Da Gläubiger von Schuldverhältnissen, insbesondere Kreditverträgen, mit nahezu wertlosem Geld befriedigt worden wären, sah sich das Reichsgericht zu einer normativen Korrektur der Rückzahlungsansprüche veranlasst.
 Dieser Einbruch der politischen Wirklichkeit in die Sphäre des positiven Rechts schlug für Rüthers die methodische Schneise, infolge derer später die Umwertung des positiven Rechts im NS ermöglicht wurde. Bekannt wurde Rüthers in diesem Zusammenhang mit der Aussage, dass Methodenfragen Verfassungsfragen sind. Für Zivilrechtler, die sich gerne als unpolitische Sachwalter des Rechts sehen, ist Rüthers’ Arbeit dahingehend lehrreich, als dass sie verdeutlicht, wie sehr die Privatrechtsordnung mit ihren offenen Klauseln – Grundsatz von Treu und Glauben oder der Verkehrssitte – die politische Neuordnung eines Staates determinieren kann. So waren es im NS mitnichten nur die großen Würfe des Ermächtigungsgesetzes oder der Nürnberger Rassegesetze, die die revolutionäre Umgestaltung der Verhältnisse ermöglichten, sondern gerade die evolutionäre Anpassung der Judikatur an politische Wertungen (!).
Dieser Einbruch der politischen Wirklichkeit in die Sphäre des positiven Rechts schlug für Rüthers die methodische Schneise, infolge derer später die Umwertung des positiven Rechts im NS ermöglicht wurde. Bekannt wurde Rüthers in diesem Zusammenhang mit der Aussage, dass Methodenfragen Verfassungsfragen sind. Für Zivilrechtler, die sich gerne als unpolitische Sachwalter des Rechts sehen, ist Rüthers’ Arbeit dahingehend lehrreich, als dass sie verdeutlicht, wie sehr die Privatrechtsordnung mit ihren offenen Klauseln – Grundsatz von Treu und Glauben oder der Verkehrssitte – die politische Neuordnung eines Staates determinieren kann. So waren es im NS mitnichten nur die großen Würfe des Ermächtigungsgesetzes oder der Nürnberger Rassegesetze, die die revolutionäre Umgestaltung der Verhältnisse ermöglichten, sondern gerade die evolutionäre Anpassung der Judikatur an politische Wertungen (!).
Diese schufen den methodischen Raum, in dem etwa positiv unangreifbare vertragliche Einigungstatbestände zwischen sog. Reichsdeutschen und „Rassefremden“ aufgelöst werden konnten. Zwar bildete für Rüthers die nationalsozialistische Re-und Entmaterialisierung des Rechtsstaats den Anlass seiner Untersuchungen, doch zeigt seine Rückblende auf die Aufwertungsrechtsprechung, dass es sich um ein umfassendes rechtswissenschaftliches Anliegen handelte. Es lässt sich nämlich mit guten Gründen bestreiten, dass die bundesrepublikanische „Verfassungsekstase“ die richtige Lehre aus einer Epoche der totalen Mobilmachung aller ideologischen Rechtsressourcen war.
IV. Richterrecht als Schicksal
So führte Rüthers später seine Kritik an einem entgrenzten Jurisdiktionsstaats fort, indem er wiederholt das politisierte Streikrecht, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder die dogmatischen Neuschöpfungen des Bundesverfassungsgerichts angriff. Doch führt die teils mit Verve vorgetragene Kritik an der heimlichen Revolution vom Rechts- zum Richterstaat – so Rüthers´ gleichnamiger Essay – zu einem eingangs aufgezeigten Dilemma: denn ein Recht ohne richterliche Auslegung ist nicht denkbar. Auch sind Normen aus guten Gründen in abstrakte Tatbestände gefasst, die auf eine Vielzahl von Fällen anwendbar sind. Die Alternative wäre eine tendenziell uferlose Kasuistik, die der Rechtsprechung jede Flexibilität nähme, auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren. Wenn also der Jurisdiktionsstaat das Schicksal des Rechtsstaats ist, ist die Methodenfrage die Schicksalsfrage des Rechts. Eine denkbare Grenze zwischen Auslegung, Einlegung und Beugung soll im nächsten Beitrag skizziert werden.
Beitragsbild / Symbolbild: nitpicker; Bild in der Mitte: Cameris; Bild unten: Brian-A-Jackson / alle Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard
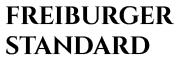




Hinterlassen Sie einen Kommentar