Von Achim Baumann
Man kennt es schon lange: Durch ein „Wording“ wird Panikmache betrieben und diejenigen, die für die inflationäre Verbreitung des Wortes gesorgt haben, bieten natürlich umgehend eine Lösung an. Das fing schon mit „Waldsterben“ an, fand seinen Höhepunkt in der „Klimakrise“, als nächstes steht der „Wasserstress“ auf dem Programm. Nun kommt erst einmal der „Hitzebetroffenheitsindex“. Denn, ehrlich gesagt, wer ist von der Hitze wie an diesen Tagen – heute ist Sonntag, der 22. Juni mit Durchschnittstemperaturen von 30 bis 35 Grad Celsius – nicht betroffen? Allen ist warm, ob sie im geschlossenen Raum jeden warmen Luftzug vermeiden oder ob man am heimischen Badestrand am See liegt. Das war vor Hundert Jahren nicht anders als heute. Aber nun könnte man „hitzebetroffen“ sein…
 Klimawandel ist real
Klimawandel ist real
Dass der Klimawandel real ist, ist ein Fakt. Ob aber die Menschheit einen erheblichen Anteil daran hat, ist zweifelhaft, gleichwohl der polit-mediale Komplex den menschengemachten Klimawandel für alles verantwortlich macht, was bei uns nicht funktioniert. Unbestritten ist aber tatsächlich, dass mit der Zunahme extremer Hitzetage im Zuge des Klimawandels die gesundheitliche Gefährdung weiter Teile der Bevölkerung steigt – besonders betroffen sind ältere Menschen, chronisch Kranke, Kinder sowie Menschen mit eingeschränkten sozialen Ressourcen. Das ist aber nun wirklich nichts Neues. Es sind Binsenwahrheiten! Umso kälter es im Winter ist, umso höher die Grippe-Infektionszahlen und umso wärmer es im Sommer ist, umso höher ist die Sterblichkeitsrate bei den zuvor genannten Gruppen.
Eigentlich ein wertneutraler Begriff
Um das Ausmaß dieser Gefährdung regional zu erfassen und gezielt vorbeugende Maßnahmen zu ermöglichen, wurde der sogenannte „Hitzebetroffenheitsindex“ entwickelt. Das Konzept stammt ursprünglich aus dem Bereich der Public-Health-Forschung und wurde im deutschsprachigen Raum unter anderem vom mittlerweile sattsam bekannten Robert Koch-Institut (RKI), dem chronisch Gefahr witternden Umweltbundesamt (UBA) sowie einzelnen Landesgesundheitsbehörden in Deutschland aufgegriffen und weiterentwickelt. In Österreich findet das Instrument Anwendung im Rahmen der Klima- und Gesundheitsstrategien des Gesundheitsministeriums, des Umweltbundesamts sowie in Projekten des Klimafonds wie KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen. Kürzlich stellte auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine entsprechende Studie vor.
Nur ein einfaches Instrument zur Bestimmung von hitzegefährdeten Räumen?
Der Hitzebetroffenheitsindex verfolgt eigentlich nur das simple Ziel, jene Regionen, Stadtteile oder Bevölkerungsgruppen zu bestimmen, die durch Hitze besonders gefährdet sind. Er kombiniert dabei verschiedene Datenkategorien, die sich grob in drei Bereiche einteilen lassen: Erstens die Exposition, also die tatsächliche Hitzeeinwirkung in einem Gebiet, gemessen etwa an der Zahl der heißen Tage (über 30 Grad Celsius), Tropennächte oder urbaner Hitzeinseln. Zweitens die Empfindlichkeit der Bevölkerung – darunter fallen Indikatoren wie Altersstruktur, Gesundheitsstatus oder soziale Lage. Drittens wird die Anpassungskapazität berücksichtigt: Wie gut sind die Menschen vor Ort in der Lage, mit Hitze umzugehen? Zugang zu kühlen Wohnräumen, Begrünung, medizinischer Versorgung oder sozialen Unterstützungsnetzen fließen hier ein. Aus der Verknüpfung dieser Daten entsteht ein Indexwert, der auf Karten dargestellt werden kann. Kommunen nutzen diese Karten zunehmend zur gezielten Planung von Hitzeaktionsplänen.
 Brauchbar oder eher unbrauchbar?
Brauchbar oder eher unbrauchbar?
Trotz seines pragmatischen Nutzens ist deieser „Hitzebetroffenheitsindex“ nicht frei von methodischen Schwächen. Eine erste Problematik liegt in der Datenbasis: Häufig kommen gesammelte statistische Daten zum Einsatz, etwa aus Volkszählungen oder regionalen Wetteraufzeichnungen. Diese sind jedoch oft nicht aktuell oder in zu grober räumlicher Auflösung verfügbar, um tatsächliche lokale Unterschiede adäquat abzubilden. Vor allem städtisches Bedingungen, wie sie durch dichte Bebauung, Asphaltierung oder fehlende Durchlüftung entstehen, bleiben in vielen Fällen unberücksichtigt. Zudem ist die Auswahl und Gewichtung der verwendeten Datengrundlagen nicht eindeutig geregelt.
Wenn die Realität komplexer ist als die Datenlage
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die fehlende Erfassung subjektiver Betroffenheit. Kein Wunder, wenn alle jammern, die Medien über die besondere Hitze klagen, folgt man diesem Chor automatisch und fühlt sich auch „hitzebetroffen“. Der Index bildet zwar grundsätzlich gewisse Risikofaktoren ab, nicht aber, wie einzelne Menschen konkret mit Hitze umgehen, wenn es wärmer wird. Der eine geht in den Keller schlafen, der andere nutzt die Gelegenheit zum Zelten.
Geringer politischer Nutzen und Instrumentalisierungsgefahr durch Klima-Hysteriker
Die Anwendung des „Hitzebetroffenheitsindex“ erfolgt zunehmend im Rahmen kommunaler und staatlicher Steuerungspolitik – etwa bei der Vergabe von Fördergeldern für Hitzeschutzmaßnahmen oder der Priorisierung von städtebaulichen Anpassungsprojekten. Dies macht das Instrument wertvoll, birgt aber auch die Gefahr der politischen Instrumentalisierung: Wer die Definition, Auswahl und Gewichtung der Indexkriterien festlegt, bestimmt indirekt, welche Gruppen als besonders schutzwürdig gelten – und wo Ressourcen konzentriert werden. Und wer das ist, ist klar: Die selben, die dann von der zunehmenden Hitze und ihren Gefahren schwaffeln.
Kritik fast nur von der AfD
„Ich frage mich, wie unsere Vorfahren überhaupt überleben konnten ohne ‚Hitzebetroffenheitsindex‘“, fragt sich der wohnungspolitische AfD-Fraktionssprecher Sandro Scheer (MdL) zurecht und ergänzt:
„Was auf den ersten Blick wie eine sachlich neutrale Analyse urbaner Hitzephänomene wirkt, ist in Wahrheit ein politisches Instrument zur Legitimation öko-ideologischer Eingriffe in städtische Planungsfreiheit und kommunale Selbstverwaltung. Statt konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung urbaner Lebensverhältnisse zu bieten, wird mit dramatischer Farbgebung (‚Rote Karte‘) ein Schuldsystem etabliert, das allein auf formalen Daten wie Flächenversiegelung oder Vegetationsanteil beruht – ohne soziale, wirtschaftliche oder städtebauliche Kontexte zu berücksichtigen. Zentrale Parameter wie Gebäudealter oder auch Bebauungsschatten bleiben unberücksichtigt. Der DUH-Index blendet systematisch soziale Lebenswirklichkeit, ökonomische Notwendigkeiten und technische Alternativen wie Gebäudedämmung oder Lüftung aus. Viele der nun gescholtenen Städte wurden bewusst verdichtet gebaut, um Flächen zu sparen, Mobilität effizient zu organisieren und günstigen Wohnraum zu ermöglichen. Forderungen nach ‚Entsiegelung‘ und ‚mehr Grün‘ klingen in der Theorie harmlos – in der Praxis führen sie zu steigenden Mieten, Abrissplänen und einer Ausdünnung urbaner Infrastruktur. Die Politik sollte sich hüten, diesem medialen Druckmittel nachzugeben.“
Ein wichtiges Werkzeug mit Verbesserungsbedarf
Damit bringt es die AfD auf den Punkt: Der „Hitzebetroffenheitsindex“ könnte ein sinnvolles Instrument sein – oder besser werden. Doch seine Aussagekraft steht und fällt mit der Qualität der Daten und der Vegleichbarkeit der Methodik. Aber solange die gleichen grünroten Panikmacher – wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe (DUH) – damit arbeiten, bleibt der Begriff einfach zu unseriös.
Beitragsbild / Symbolbild und Bild oben: VladisChern; Bild darunter: New Africa / beide Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

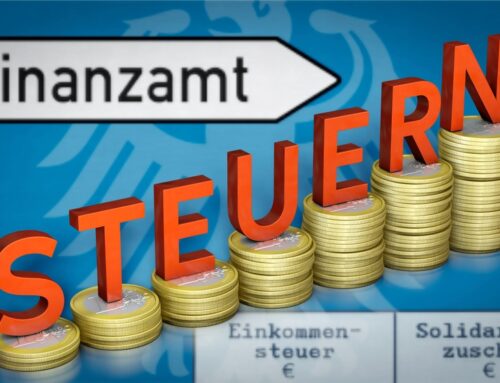



Hinterlassen Sie einen Kommentar