Von Roderich A.H. Blümel
Sächsische Separatisten, Knockout 51, Revolution Chemnitz, Autonome Nationalisten Göppingen, Aktionsbüro Mittelrhein und viele mehr – seit mehr als zehn Jahr häufen sich die Verfahren gegen rechte Gruppen nach § 129 StGB, einen Überblick über die Zahl der Fälle hat kaum noch jemand. Die Vorwürfe stehen oft diametral den Verfahrensdauern und Strafen entgegen. Der Grund für das offensichtliche Auseinanderfallen ist, dass der § 129 StGB eigentlich nicht für Whatsapp-Gruppen mit unvorsichtigen Formulierungen oder politische Organisationen, die Aufkleber verkleben, konzeptioniert ist, sondern für Gruppen der organisierten Kriminalität. Dennoch ist er zu einem der Lieblingsparagrafen der Repressionsbehörden geworden und die Anwendung auf Personengefüge des oppositionellen Milieus geht bis zum offenen Missbrauch. Doch der Reihe nach.
 Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
§ 129 StGB schützt das Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Bildung einer kriminellen Vereinigung hat eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren Gefängnis zur Folge. Damit eine solche vorliegt, muss eine Vereinigung bestehen, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist und bei der die Begehung von Straftaten nicht nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist.
Eine Vereinigung ist nach der Legaldefinition des § 129 II StGB ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.
Die Besonderheit des § 129 StGB ist dabei, dass die reine Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung bereits strafbar ist. Das heißt, man muss dem individuellen Angeklagten keine spezifische strafbare Handlung nachweisen (etwa, dass er einen Raub oder eine Körperverletzung begangen hat), sondern nur das Bestehen der Organisation und die Mitgliedschaft bei dieser beweisen. Letzteres ist für die Repressionsbehörden weitaus einfacher, als konkrete Taten einzelnen Personen zuzuordnen und dies gerichtsfest zu beweisen. Dies ist gerade auch der Sinn des § 129 StGB, denn der „Mafiaparagraf“ zielt auf Strukturen der organisierten Kriminalität, die konspirativ vorgehen, nach außen abgeschottet sind und ihre Strukturen versuchen zu verschleiern. Nicht selten gibt es in solchen Gruppen ein arbeitsteiliges Vorgehen, wonach gerade die Führungsleute selten konkret einzelne Tatbestände erfüllen (sich also nicht „selbst die Finger schmutzig machen“). Für eine Strafverfolgung dieser als Gehilfe, Mittäter oder mittelbarer Täter müsste man jedoch auch stets die objektiven und subjektiven Tatbestände für jedes einzelne Delikt klären – eine oft unmögliche Angelegenheit. Dahingehend ist es sinnvoll, nicht jedem Beteiligten an einem Drogenring konkrete Handlungen und Beiträge zuordnen zu müssen, sondern auf die Mitgliedschaft in einer solchen kriminellen Vereinigung abstellen zu können.
§ 129 StGB als Türöffner
Der § 129 StGB bietet dafür nicht nur einen erleichterten Tatbestand, sondern ermöglicht den Ermittlungsbehörden fast alle Maßnahmen der Strafprozessordnung: die Telefonkommunikationsüberwachung nach § 100a StPO, die Online-Durchsuchung nach § 100b StPO und bei besonders schweren Taten die akustische Wohnraumüberwachung nach § 100c und die akustische Überwachung außerhalb des Wohnraums. Damit können Ermittler über Monate nahezu alle Bereiche des Lebens einer Person ausspähen, dementsprechend sind die Verfahrensakten in solchen Verfahren regelmäßig von zahlreichen Seiten an entsprechenden Observationsprotokollen geprägt. Seit langem wird – nicht nur bei politischen Prozessen – kritisiert, dass der Tatbestand in der Praxis vor allem zur Eröffnung und Ermöglichung umfassender Ermittlungsmöglichkeiten dient. Dahingehend wird die Vorschrift auch als „Einstieg“ und „Türöffner“ für weitreichende Ermittlungsmaßnahmen bezeichnet.[1] Denn durch das Heranziehen des § 129 StGB sind Überwachungsmaßnahmen möglich, die für die einzelnen Tatbestände jeweils nicht zulässig gewesen wären. Der BGH hält ein solches Ausforschen für unproblematisch, sodass die aus den umfangreichen Möglichkeiten des § 129 StGB gewonnen Ermittlungsergebnissen unabhängig davon verwertet werden können, ob der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung bewiesen werden kann.[2] Die faktische Beweislastumkehr, dass der Gruppenzweck nicht das Begehen von Straftaten darstellt oder aber der einzelne Angeklagte kein Mitglied der Vereinigung war, erschwert die Verteidigung zusätzlich.
Angeklagte werden aus dem Leben geworfen
Verfahren nach § 129 StGB sind auch deshalb regelmäßig von langer Dauer und enormen Aufwand geprägt. Jahrelange Prozesse mit entsprechend langer Untersuchungshaft für teils zahlreiche Angeklagte sind keine Seltenheit. Dies wirft die Angeklagten regelmäßig aus ihrem Leben, selbst wer etwa nach zwei Jahren Untersuchungshaft entlassen wird, kann kaum ein normales Leben führen, wenn er zwei bis drei Mal die Woche vor Gericht muss. Selbst bei einem Freispruch gibt es keine adäquate Entschädigung, aufgrund der hohen Kosten des Verfahrens bedeutet ein Schuldspruch zudem regelmäßig die Privatinsolvenz der Angeklagten.
Gerade aus diesen Gründen ist der § 129 StGB perfekt zur Bekämpfung der politischen Opposition, denn durch monatelange intensive Ermittlungen kann nicht nur das Privatleben der Betroffenen ausgeleuchtet werden, sondern auch ihr politisches Umfeld. Dass die Ergebnisse daraus auch anderen Behörden für Ergänzung ihrer Informationen und gerichtsfeste weitere Verfahren weitergegeben wird, ist bekannt. Gleichzeitig ermöglicht es, ganze politische Gruppen auf einmal auszuschalten und diese – selbst bei einem Freispruch – über Jahre zu lähmen. Die Medienwirksamkeit eines solchen Prozesses und die abschreckende Wirkung ergeben ein übriges.
Neben der Belastung durch die Ermittlungsmaßnahmen und dem Verfahren ist auch die Stigmatisierungswirkung zu beachten. Presseartikel und Anklageschriften, in denen von „krimineller Vereinigung“ gesprochen wird, rufen automatisch das Bild der organisierten Kriminalität hervor. Selbst Sympathisanten und Freunde solchermaßen verfolgter Personen distanzieren sich in der Regel schnell und stellen ihre Unterstützung ein. Das Agieren des Landesverbandes der AfD Sachsen im Verfahren gegen die „sächsischen Separatisten“ ist geradezu ein Paradebeispiel dafür. Neben der Verfolgung kommt also oft noch eine Isolation hinzu, wenn sich etwa Freunde oder Familie von einem abwenden.
Gilt die Existenz einer „kriminellen Vereinigung“ erst einmal als bewiesen, kann sich in folgenden gerichtlichen Verfahren darauf bezogen werden. Regelmäßig laufen deswegen mehrere Prozesse, zunächst werden die (vermeintlichen) Gruppenführer angeklagt und in späteren Prozessen die (vermeintlichen) Unterstützer. Letztere sehen sich daher regelmäßig über Jahre mit der Aussicht auf einen kommenden Prozess konfrontiert.
 Politische Gruppen sind besonders einfach zu verfolgen
Politische Gruppen sind besonders einfach zu verfolgen
Die Konstruktion einer „Vereinigung“ ist dabei paradoxerweise bei politischen Gruppen viel einfacher als bei tatsächlichen Gruppen der organisierten Kriminalität. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 ist weder ein einheitlicher, nach festen Regeln gebildeter Gruppenwille, dem die Mitglieder sich unterordnen, notwendig, noch eine Gruppenidentität.[3] Nach Ansicht des BGH reicht das persönliche Gewinnerzielungsinteresse, etwa bei einer Drogenbande, jedoch noch nicht für eine Mitgliedschaft aus, viel mehr liegt nur eine für ein gemeinsames Interesse nicht ausreichende Parallelität von Individualinteressen vor.[4] Selbst die gemeinsame Begehung von Straftaten – man denke beispielsweise an Rockergruppierungen – reicht noch nicht für ein gemeinsames, eine Vereinigung bildendes Interesse aus. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei Vereinigungen „zur Verfolgung weltanschaulich-ideologischer, religiöser oder politischer Ziele“ das gemeinsame Interesse eben aus diesem Grund.[5] Mit anderen Worten: Eine auf Gewinnerzielungsabsicht gerichtete Drogenhändlerbande kann u. U. keine Vereinigung i. S. d. § 129 StGB sein, eine patriotische Jugendgruppe, bei der Mitglieder vereinzelt strafrechtlich in Erscheinung treten, dagegen schon. Eine gewisse Einschränkung gibt es dahingehend, dass der „Zweck oder Tätigkeit“ auf die Begehung von Straftaten mit einer Höchststrafe von mindestens zwei Jahren gerichtet sein müssen. Dies betrifft jedoch, wenn man das StGB durchsieht, zahlreiche Alltagsdelikte und insbesondere auch politische Straftatbestände. Dazu gehören etwa Körperverletzung (§ 223 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), die gemeinschädliche Sachbeschädigung (§ 304) und Volksverhetzung (§ 130 StGB).
Der deutsche Gesetzgeber bleibt dabei weit hinter dem europäischen Rahmenbeschluss zurück. Dieser sieht eine Mindesthöchststrafe von vier Jahren als Grenze und vor allem die Voraussetzung eines „unmittelbaren oder mittelbaren finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteils“ als Tatbestandsmerkmal vor.[6] Würde diese Voraussetzung in das deutsche Recht umgesetzt werden, würde sich die Verfolgung politischer Gruppen unter Missbrauch des § 129 StGB über Nacht erledigen. Ob dies der Grund für die fehlende Umsetzung ist, wo doch sonst Berlin gerne Brüssels Musterschüler spielt, kann nur gemutmaßt werden. Selbst Amnesty International kritisiert die Anwendung des § 129 StGB auf politische Gruppen und spricht vom Missbrauch, um friedlichen Protest zu kriminalisieren – jedoch nur hinsichtlich der Klimaaktivisten der Letzten Generation.[7] Von linker Seite wird die Anwendung des § 129 StGB auf politische Gruppen durchaus zu Recht als „Feindstrafrecht“ (siehe dazu auch den Beitrag vom Freiburger Standard „Feindstrafrecht als politisches Sicherheitsrecht – Eine theoretische Umrahmung“) bezeichnet und die Beweislastumkehr in solchen Prozessen kritisiert.[8] Wie immer ist jedoch die linke Seite blind dafür, dass es weitaus mehr Anwendungen gegen rechts gibt und die Verfahren deutlich rechtsmissbräuchlicher sind.
Wer ist strafbares Mitglied?
Auch bei der Frage der Mitgliedschaft haben politische Gruppen das Nachsehen. Nach Ansicht des BGH reicht es zwar „für die Strafbarkeit nach diesen Vorschriften […] nicht aus, bloß rein passives Mitglied in einer Vereinigung zu sein. Das Faktum der Mitgliedschaft begründet für sich noch keinen rechtswidrigen Zustand; gefordert ist nach dem Gesetzeswortlaut vielmehr eine Beteiligung als Mitglied, also eine Förderung, in der sich die Eingliederung des Täters in die Organisation manifestiert“.[9] Nicht erforderlich für eine Mitgliedschaft ist jedoch, sich an den Straftaten der Vereinigung zu beteiligen. Als Förderung reicht auch ein sonstiger Beitrag zum Zweck der Vereinigung.[10] Auch hier haben politische Aktivisten einen klaren Nachteil. Natürlich will ein politischer Aktivist den Zweck einer politischen Vereinigung fördern, deswegen ja ist er politisch aktiv. Eine Mitgliedschaft in einer politischen Gruppe ohne „Förderung, in der sich die Eingliederung des Täters in die Organisation manifestiert“ ist im Gegensatz zu kriminellen Banden kaum denkbar. Damit kann der politische Aktivist einer Gruppe für rein legalen politischen Aktivismus eine jahrelange Haftstrafe erhalten, selbst wenn er nie auch nur eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, wenn durch Straftaten anderer Gruppenmitglieder das Gericht der Meinung ist, die Organisation stelle eine kriminelle Vereinigung dar.
 Nahezu alles kann Anlass für Ermittlungen sein
Nahezu alles kann Anlass für Ermittlungen sein
Damit zeigt sich die besondere Gefahr des § 129 StGB für politische Gruppen. Eine riesige Bandbreite sozialadäquater und legaler Aktivitäten – im Bereich politischer Gruppen etwa Stammtische, Flugblattverteilungen etc. – kann Anlass für ein solches Verfahren sein, wenn zusätzlich Straftatbestände in Erscheinung treten, und sei es nur das Auftauchen von politischen Graffiti. Bei Bejahung eines entsprechenden Anfangsverdachts werden die Strafverfolgungsbehörden in großem Umfang von rechtlichen Beschränkungen befreit und können Personen ermitteln, gegen die selbst nie der Verdacht der Begehung einer Straftat bestehen würde.
Beispiele aus der Praxis
Die bisherigen Beispiele aus der Praxis trafen vor allem nationalistische Gruppen (manche würden sie wohl unzutreffend als „altrechts“ bezeichnen). Dies liegt maßgeblich daran, dass die Ausweitung des Repressionsapparats auf konservativ-patriotische Gruppen erst in den vergangenen Jahren erfolgte und diese Gruppen über Jahrzehnte über keine aktivistischen, insbesondere keine jugendlichen Gruppen verfügte, die naturgemäß besonders gefährdet sind. Eine repressive (nicht legitime!) Anwendung des § 129 StGB auf die Identitäre Bewegung wäre aber beispielsweise denkbar gewesen, genauso wie die auf andere patriotische Gruppen. Die Frage der politischen Radikalität ist hier kein entscheidendes Merkmal. Das Konstrukt der „sächsischen Separatisten“ zeigt, dass nahezu jeder politischer Akteur betroffen sein kann.
Zwei Beispiele sollen die Anwendung des § 129 StGB zeigen:
Autonome Nationalisten Göppingen
Im Prozess um die „Autonomen Nationalisten Göppingen“ wurden vier Angeklagte als Rädelsführer wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Die Haftstrafen waren für zwei Angeklagte einmal zwei Jahre und vier Monate und einmal zwei Jahre und zwei Monate, ein Angeklagter erhielt eine Jugendstrafe von einem Jahr und zwei Monaten zur Bewährung und ein weiterer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Die Angeklagten saßen teilweise mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft, der Prozess wurde über 45 Verhandlungstage geführt, mehr als 120 Zeugen wurden vernommen und über 160 abgehörte Telefongespräche ausgewertet. Insgesamt war die Gruppierung bis zu ihrem parallel zum Strafverfahren ausgesprochenen Verbot rund fünf Jahre lang politisch aktiv. Der Gruppe wurden in diesem Zeitraum rund 50 Straftaten zugerechnet, wobei es sich in der absoluten Mehrheit um Sachbeschädigungen in Form von politischen Graffitis und dem Kleben von Plakaten (!) sowie um einzelne Körperverletzungen und Verleumdungen in Auseinandersetzungen mit radikalen und militanten politischen Gegnern handelte. Die Körperverletzungsdelikte konnten am Ende der Verhandlunge nicht einmal zugerechnet werden, da es sich jeweils um ungeplante Spontantaten handelte, bei denen oftmals die Rechtswidrigkeit mit Blick auf etwaige Notwehrsituationen fraglich war. Am Ende bestanden die Straftaten also nahezu ausschließlich aus Sachbeschädigungen in Form von politischen Sprühereien und verklebten Plakaten. Im Hinblick auf einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren und unter Berücksichtigung, dass es sich mehrheitlich um harmlose politische Graffitis und Plakaten handelte, wohl kaum das, was man generell unter „krimineller Vereinigung“ versteht. Hintergrund dürfte auch weniger die tatsächliche strafrechtliche Bedeutung gewesen sein. Denn seit ihrer Gründung im Jahr 2009 war die Gruppe eine der führenden politischen Gruppen im südwestdeutschen Raum und organisierte überregionale Versammlungen mit hunderten Teilnehmern. Die Behörden rechneten der Vereinigung hunderte (legale!) Aktivitäten zu und die parallel erlassene Verbotsverfügung zeigt, dass diese politischen Aktivitäten der Hauptgrund für das Verfahren waren und nicht etwa eine niedrige zweistellige Zahl von illegalen Graffiti oder Plakate pro Jahr oder eine nächtliche Schubserei zwischen politischen Gegnern.
Aktionsbüro Mittelrhein
Den wohl krassesten Fall an einem Missbrauch des § 129 StGB stellt das Verfahren gegen das sogenannte Aktionsbüro Mittelrhein dar. Gegen die 26 vermeintlichen Mitglieder lief seit 2012 das Verfahren vor dem Landgericht Koblenz wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, aufgrund verschiedener prozessualer Gründe wurde das Verfahren zweimal neu begonnen und erst im September 2019 im dritten Hauptverfahren eingestellt. Die Anklageschrift umfasste fast 1000 Seiten. An dem Verfahren waren bis zu 52 Strafverteidiger beteiligt, es umfasste rund 500 Befangenheitsanträge, 240 Beweisanträge und 400 weitere Anträge. Insgesamt wurden über 300 Verhandlungstage durchgeführt. Es dürfte wenige Verfahren geben, die ein solches Ausmaß erreichen.
Die Gruppe war etwa seit 2004 unter teils anderen Namen und in wechselnden Personenzusammensetzungen politisch aktiv. Im Vergleich zur Gruppengröße und Ausmaß ihrer Aktivitäten sind die strafrechtlichen Vorwürfe abseits der Bildung einer kriminellen Vereinigung fast schon lächerlich. Die vorgeworfenen Straftaten bezogen sich unter anderem auf einen Fall des schweren Landfriedensbruchs, als (vermeintliche) Mitglieder der Gruppe bei einem Trauermarsch in Dresden 2011 in gewalttätige Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern verwickelt wurden. Daneben soll es in den Jahren 2009, 2010 und 2011 ebenfalls im Rahmen von Demonstrationen zu Gewalttaten gegen militante Linksextremisten gekommen sein. Bei allen vorgeworfenen Straftaten lagen also situationsbezogene Auseinandersetzungen von einzelnen Mitgliedern der Gruppe vor. Der Gruppe wurde darüber hinaus vorgeworfen, Adressen und Bilder von Mitgliedern der linksradikalen Szene gesammelt zu haben. Selbst bei einem berechtigten Anfangsverdacht für die einzelnen Delikte ergibt sich insgesamt wohl kaum das Bild einer kriminellen Vereinigung.
 Trotzdem mussten die Angeklagten, die sich bis zu anderthalb Jahre in Untersuchungshaft befanden, mehr als sieben Jahre teilweise bis zu dreimal die Woche Gerichtstermine wahrnehmen. Selbst eine Haftstrafe von wenigen Jahren bei tatsächlichen Verurteilungen wäre für die Betroffenen weniger einschneidend in ihr Leben gewesen als der letztendlich ohne Verurteilung durchgeführte, jahrelange Prozess. Mehr als sieben Jahren waren die Angeklagten, gegen die am Ende keine Verurteilung erfolgte, von jeder normalen Lebensführung abgeschnitten und hatten die Möglichkeit einer Verurteilung zu einer jahrelangen Haftstrafe und Privatinsolvenz vor Augen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung standen auch beim Aktionsbüro Mittelrhein nicht die tatsächlichen strafrechtlichen Vorwürfe, sondern die politischen Aktivitäten der Mitglieder und der „Erfolg“, dass die politischen Aktivitäten zurückgegangen sind.
Trotzdem mussten die Angeklagten, die sich bis zu anderthalb Jahre in Untersuchungshaft befanden, mehr als sieben Jahre teilweise bis zu dreimal die Woche Gerichtstermine wahrnehmen. Selbst eine Haftstrafe von wenigen Jahren bei tatsächlichen Verurteilungen wäre für die Betroffenen weniger einschneidend in ihr Leben gewesen als der letztendlich ohne Verurteilung durchgeführte, jahrelange Prozess. Mehr als sieben Jahren waren die Angeklagten, gegen die am Ende keine Verurteilung erfolgte, von jeder normalen Lebensführung abgeschnitten und hatten die Möglichkeit einer Verurteilung zu einer jahrelangen Haftstrafe und Privatinsolvenz vor Augen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung standen auch beim Aktionsbüro Mittelrhein nicht die tatsächlichen strafrechtlichen Vorwürfe, sondern die politischen Aktivitäten der Mitglieder und der „Erfolg“, dass die politischen Aktivitäten zurückgegangen sind.
Solidarität statt Distanzierung
Auch wenn solche Mammutverfahren wie der des Aktionsbüros Mittelrhein eine Ausnahme darstellen, so zeigt die Zahl der Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen rechte Gruppen kontinuierlich nach oben. Der § 129 StGB ist nicht nur ein Türöffner zur umfangreichen Observierung politischer Gruppen, sondern auch eine repressive Dampfwalze, mit der ganze aktivistische Gruppen regelrecht plattgewalzt werden können. Unter die Räder kommen dabei oft auch ganze Biografien und Lebenswege, was zumindest billigend in Kauf genommen, wenn nicht sogar mit beabsichtigt wird. Der § 129 StGB wird bewusst einseitig gegen Gruppen der politischen Rechten angewandt und als Mittel der Repression benutzt. Daran wird so schnell nichts zu ändern sein. Was jedoch bereits jetzt geändert werden kann, ist der Umgang mit solchen pressewirksamen Verfahren: Solidarität statt Distanzierung, Unterstützung statt Isolation, politische Kritik an politischer Repression!
Quellen:
[1] https://www.lto.de/recht/meinung/m/kriminelle-vereinigung-thomas-fischer-letzte-generation
[2] Singelnstein/Winkler: Wo die kriminelle Vereinigung beginnt, in: NJW 2023, 2815.
[3] Leipziger Kommentar StGB/Krauß, § 129 Rn. 40, Band 8 2021.
[4] BGH, Beschluss vom 28. Juni 2022 – 3 StR 403/20, Rn. 9.
[5] BGH, Urteil vom 2. Juni 2021 – 3 StR 21/21, Rn. 21ff.
[6] Singelnstein/Winkler: Wo die kriminelle Vereinigung beginnt, in: NJW 2023, 2815.
[7] https://www.amnesty.de/pressemitteilung/deutschland-paragraf-129-amnesty-fordert-reform-friedlichen-protest-schuetzen
[8]Siehe bspw. https://www.akweb.de/politik/urteil-im-lina-e-prozess-im-zweifel-gegen-die-angeklagten-2/
[9] BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 – AK 13 – 14/19, AK 16 – 19/19, AK 13/19, AK 14/19, AK 16/19.
[10] Leipziger Kommentar StGB/Krauß, § 129 Rn. 100, Band 8 2021.
Beitragsbild / Symbolbild: Lightspring / Bild oben: Jorm-Sangsorn; Bild in der Mitte: icedmocha; Bild unten: Guitarfoto / alle Shutterstock.com
Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard



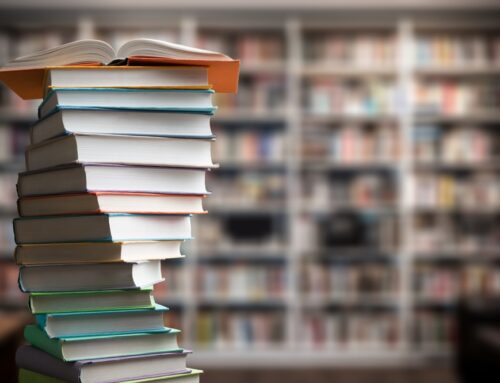

Hinterlassen Sie einen Kommentar