In einer neuen Reihe betrachten wir in loser Folge herausragende Errungenschaften des Abendlandes. Hier und dort liest man, dieses sei untergegangen. Diese Reihe zeichnet den Gegenentwurf.
Mit dem heutigen Palmsonntag tritt die Kirche in die Karwoche ein. Wer über die Höhepunkte der Liturgie hinaus seine Seele dem Leiden und Sterben Jesu Christi zuneigen will und sich dafür drei volle Stunden der Muse gönnen kann, dem empfehle ich eines der größten Werke, die das Abendland, oder näher gefasst die deutsche Hochkultur, hervorgebracht hat: Bachs Matthäuspassion.
Die Freiburger Chorszene ist weltweit sicher die dichteste – sowohl quantitativ als auch qualitativ. So war dieses Jahr am 20. März der Bachchor dran, für die Freiburger Bürger dieses Werk aufzuführen. Wer wie ich dieses Ereignis verpasst hat, dem bleiben andere Möglichkeiten. Es gibt ja noch die analoge Schallplatte und deren Nachfolger.
Ich möchte den Artikel unterteilen in:
- eine kleine unwissenschaftliche Hinführung zum Werk und dessen Schöpfer
- die Möglichkeiten und Grenzen einer heutigen Aufführung
- eine konkrete Plattenempfehlung
- eine kleine persönliche Nachbetrachtung
Dies geschieht alles aus dem Blickwinkel eines ambitionierten Amateurs, der dieses Werk schon einmal als Chor-Tenor 1 vor vielen Jahren (auswendig) gesungen hat.
Hinführung zu Komponist und Werk
Bach ist nur unter zwei Gesichtspunkten im Ansatz zu verstehen – ganz wird uns das sowieso nicht gelingen. Bach wächst erstens in der Zeit kurz nach dem 30-Jährigen Krieg und zweitens in einer Musikerfamilie auf.
Irgendwann mache ich mich mal mit Mikrophon bewaffnet auf zum Bertholdsbrunnen, um Passanten nach der Länge des 30jährigen Krieges zu fragen. Die Antworten werde ich hier veröffentlichen – versprochen.
Allen umständlichen Geschichtsinterpretationen trotzend, ist dieser Krieg für mich vor allem eines: Protestanten gegen Katholiken. Dass ich hier als traditionsbewusster Katholik über ein urprotestantisches Werk (protestantischer ist wahrscheinlich nur Kantate BWV 80: Ein feste Burg ist unser Gott) schreibe, tut dabei nichts zur Sache. Die Kirchenmusik steht bei den Protestanten nun mal mindestens auf der gleichen Ebene wie die Predigt des Pfarrers.
Die Bache (sic) sind in ihrem geographischen Umfeld als Stadtpfeiffer, Organisten und Kantoren schon lange vor Johann Sebastians Wirken gesetzt. Dies wird in der wunderbar zu lesenden Bach-Biographie von Sir John Eliot Gardiner (link) schön herausgearbeitet. Gardiner wird später im Artikel nochmal wichtig.

Früh Vollwaise wird Johann Sebastian von seinem älteren Bruder unter die Fittiche genommen und Bach schreibt unter strengstem Verbot seines Bruders hunderte von Notenblättern nachts bei düsterem Licht ab. Die weiteren Lebensstationen sind Gegenstand vieler historischer Berichte – das ersparen wir uns. Ein paar kleine Sätze zur Würdigung des Genies müssen genügen:
- Beethoven: Nicht Bach! Meer sollte er heißen!
- nicht alle Musiker glauben an Gott – an Bach glauben sie alle
- Goethe: Als ich diese Musik hörte, da vernahm ich etwas von dem, wie es sein müsste in Gott, gerade bevor Gott die Welt erschaffen hat.
Bach ist das Zentrum der Barockmusik. Im Barock hatte Musik immer eine Funktion – sie war nie für sich selbst da, wie später in der Klassik. Eine Beethoven-Sinfonie erfüllt keinen Zweck, sie ist Kunst um der Kunst willen. Musik im Barock aber diente dem Fürsten zur glanzvollen Machtdemonstration (oder auch nur zur Zerstreuung), den Kirchen als Hilfe in der Verkündigung, dem Landstreicher zum Broterwerb.
Im Barock ist es eher unüblich, bei einem schönen Akkord außerhalb des Metrums zu verweilen – so wie es in der Romantik Gang und Gäbe ist. Wenn einer Barockmusik Schönheit inne wohnt, so hat diese bereits der Komponist hinein komponiert und überlässt das nicht dem Interpreten mit seinem ausdrucksvollen Vortrag. So erklärt sich auch, weshalb Barockmusik oft ohne Dirigenten auskommt – vor allem beim häufig verwendeten 6/8-Takt. Das schwingt sich meist sehr gut von ganz alleine ein.
Johann Sebastian Bach komponierte die Matthäuspassion 1727 als Thomaskantor in Leipzig. Die Liturgie der Protestanten legte und legt bis heute größten Wert auf die Kirchenmusik und versteht diese nicht nur als schmückendes Element, sondern als Teil der Verkündigung. So war es schon zuvor Usus, die Predigt am Karfreitag – die gerne über eine Stunde dauerte – mit einer musizierten Passionsgeschichte zu umrahmen. Hierfür gibt es neben der Matthäus-Passion, die hier Gegenstand der Betrachtung ist, weitere Kompositionen wie die Johannes-Passion von Bach und weitere Passionen wie beispielsweise von Heinrich Schütz. Dass unter Bach auch Passionen der beiden anderen Evangelisten musiziert wurden, gilt heute als sicher, diese sind aber nicht vollständig erhalten.
Die Matthäus-Passion ist groß angelegt. Komponiert ist das Werk für zwei Chöre, zwei komplette Barockorchester und zusätzlich einem Knabenchor. Diese Musikergruppen spielen sich die Bälle zu, womit Bach für Dramatik und dynamische Vielfalt sorgt.
Der Werkaufbau: Die Passion des Evangelisten Matthäus wird in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil endet mit der Flucht der Jünger. Der Evangelientext selbst wird immer wieder unterbrochen – um inne zu halten und zu betrachten. Diese Unterbrechungen bestehen aus Arien, Accompagnato-Rezitativen, Chorälen und groß angelegten Chorstücken zum Teil im „Duett“ mit Solisten. Die Stilistik ist einer Kantate, wie Bach sie sonntäglich für mehrere Jahrgänge geschrieben hatte, sehr ähnlich – allerdings mit rein zeitlich monumentalem Ausmaß.
Immer wieder wird auf die in der Komposition viel verwendete Zahlensymbolik eingegangen. Dies war seinerzeit aber üblich und stellt eher heute ein Sonderfaszinosum dar. Im Barock erstellt man sich ein Kompositionsgerüst und setzt erst dann Harmonien ein.
Rainer Johannes Homburg in einem kurzen Hinführungsvideo (link):
Dieses Stück ist maximal einfach – zugleich aber auch maximal kompliziert – eine der größten musikalischen Architekturen.
Die Möglichkeiten und Grenzen einer heutigen Aufführung
Das Stück dient einem Zweck – der Verinnerlichung des Passionsgeschehens in der Karfreitagsliturgie. Heute wird es in den allermeisten Fällen aus diesem Zusammenhang herausgerissen. Ob eine Aufführung im Konzertsaal oder zu Hause vor der Musikanalage – so war das nicht gedacht. Diesen Gedankengang im Hinterkopf nimmt sich der heutige Rezipient Freiheiten heraus, die hier im Einzelnen dargestellt werden sollen. Im nächsten Abschnitt greiffe ich vor allem zwei Punkte heraus: Besetzungsstärke und der Umgang mit Dynamik und Tempo.
Von welcher Musikerstärke ist auszugehen? Hierzu der Dirigent Eugen Jochum in den Linernotes seiner Schallplatteneinspielung aus dem Jahr 1970:
Man diskutiert über große oder kleine Besetzung und so weiter. Faktisch kann man heute Monsteraufführungen mit 500 und mehr Ausführenden hören neben sogenannten „historischen“ in kleinster Besetzung, bei denen man sich darauf beruft, daß Bach selber die Passion mit nur 17 Sängern aufgeführt habe. Ich persönlich bin überzeugt, daß Bach mit diesen legendären 17 Matthäus-Passion-Sängern nicht gerade glücklich war, […] und daß er diese und viele Details der Aufführungspraxis jeweils nach den vorhandenen Möglichkeiten und ohne Dogmatik behandelt hat.

Dies führt ihn zu einer, in seinen Augen für einen größeren Konzertsaal richtigen, Aufführungsstärke von 18 Holzbläsern, 56 Streichern und 90 Singstimmen. Auch geht Jochum auf die vor allem früher anzutreffenden Verkürzungen des Werkes ein:
Arien und Accompagnato-Rezitative stellen die Betrachtung des gläubigen Christen dar (Picander: der „Tochter Zion“), mit der sich jeweils der Einzelne, das heißt, jeder der Hörer, identifiziert. Sie könnten auch an einer ganz anderen Stelle stehen, ganz fehlen oder von einem anderen Gegenstand angeregt sein! Wenn daher gekürzt werden muß, kann es nur dadurch geschehen, daß eine ganze Betrachtung, das heißt eine Arie mit ihrem Accompagnato-Rezitativ und einem eventuell zu dieser Betrachtung gehörenden Choral entfällt. Dem steht auch der Tonartenbauplan nicht entgegen.
Noch ein anderer Aspekt seiner Herangehensweise wird für unser späteres Fazit wichtig – die romantisierende Aufführung barocker Musik:
Man spricht da etwa von der Notwendigkeit, Bach (und nicht nur ihn) „aus dem Geist unserer Zeit heraus“ zu interpretieren, man geißelt „romantische Darstellung“ (wobei „romantisch“ noch eigens interpretiert werden müsste: es existiert um dieses Wort, das heute fast ein Schimpfwort geworden ist, eine eigentümliche Begriffsverwirrung), man verlangt, „sachliche“ Aufführungen und so weiter.
Er begründet seine Instrumentierung – vor allem die Besetzungsstärke anhand der Barockorgel. Diese habe
zweifellos die Klangvorstellung nicht nur für die Orgelmusik, sondern auch für Chor- und Instrumentalmusik weitgehend bestimmt. Das führt hinsichtlich gewisser Besetzungsfragen zu bestimmten Lösungen. […] Im Wesentlichen, und ganz besonders in den Chorsätzen, ist das Orchester analog der Barockorgel gruppiert. Das heißt: Streicher und Holzbläser […] bilden je ein Manual. Diese Manuale spielen entweder einzeln oder wechseln in kurzer Folge miteinander ab oder werden gekoppelt. Die starke Holzbläserbesetzung, die ich verlange und über die man sich mancherorts gewundert hat, hat hierin ihren Grund. Der Holzbläserchor muß so stark besetzt sein, daß er sowohl dem Streicherchor […] als absolut selbstständige und gleichberechtigte Gruppe erscheint; denn unzählige Stellen verlangen diese Gruppierung gleichberechtigter Gruppen. Die Zahl der Knaben sollte nicht unter 60 sein, sonst müssen sie forcieren und klingen unschön. Es können sogar bis zu 100 sein.
Das geht noch mehrere Seiten so weiter. Er findet für jede Verdickung des Apparates ein Argument. Man stelle sich vor, wie furchtbar es klingen muss, wenn zarte Holzbläser wie eine Oboe allein durch eine Mehrfachbesetzung lauter “gedreht” werden.
Zu den Chorälen folgen dann noch ein paar Allgemeinplätze. Seine Argumentationsführung ist so trivial (fast schon banal), dass man sich fragt, weshalb er hier Erklärungsbedarf sieht.
Die Choräle müssen im Ausdruck distanzierter, objektiver sein als die Soloarien und –rezitative. Sie gehören nicht zur Handlung, daher dürfen sie nie so dramatisch gebracht werden wie andere Chöre, etwa „Ja nicht auf das Fest“ oder „Laß ihn kreuzigen“ oder gar „Sein Blut komme über uns“ – sie sind eben die Betrachtung einer teilnehmenden, im Glauben ergriffenen Vielheit.
Ein für mich sehr wichtiges Thema, die Wahl der Tempi streift Jochum nur am Rande:
Der Einleitungschor ist für mich ein strömendes Meer von Klage. Dieses Strömen von Anfang bis zum Ende bestimmt das Tempo: es muß ruhig-fließend sein. Das Ganze gleicht einem großflutenden Klagegesang, entsprechend einer großangelegten Orgeleinleitung zur dramatischen Handlung. […] Man muß das Empfinden von Zeit verlieren, es könnte genauso gut noch länger dauern.
Für die vielen Freiheiten, die er sich nimmt führt er zugegebenermaßen korrekt an, dass viele Passionsaufführungen nicht mehr in Kirchen stattfinden und somit eh aus dem liturgischen Zusammenhang gerissen sind.
Sehr schön arbeitet er die kompositorische Feinheit der Streicherbegleitung der Christusworte heraus:
Diese Streicher weben gewissermaßen einen Heiligenschein um das Haupt des Erlösers.
Und nun widerspricht er sich selbst und kommt endlich zu einer der wichtigsten Aussagen, die für jeden Musiker als oberstes Gesetz gilt:
Die Kriterien für den richtigen Aufführungsstil sind auch hier nur aus dem Werk selbst zu nehmen, man kann sie nur aus der Partitur ablesen. Das ist bei Bach nicht anders als bei anderen Komponisten, nur bei ihm und der ganzen früheren Musik für uns Heutige deswegen besonders schwierig, weil wir an die äußerst differenzierten Vortragsanweisungen eines Wagners, Strauss und Bartók gewöhnt sind. Bach dagegen gibt kaum Tempo- noch Ausdrucksbezeichnungen und relativ selten dynamische Angaben.
Jeder, der sich mit Bach eingehend beschäftigt hat, wird mir recht geben: spiel‘ einfach was da steht (spiel die Tinte) – der Rest ergibt sich durch musikalisch feinfühlige Herangehensweise von selbst.
Ganz anders dagegen die Betrachtung
Sir John Eliot Gardiners in den Linernotes seiner Einspielung von 1989 (keine 20 Jahre nach Jochum).

Er hat sich lange auch wissenschaftlich mit Bach beschäftigt und sieht das Werk mehr in seinem „Verwendungszusammenhang“. Diese Sicht auf Bachs Vokalwerk, vor allem den Kantaten, trieben ihn später an, überall auf der Welt die zum jeweiligen Sonntag gehörende Kantate in unzähligen Kirchen über den Globus verteilt aufzuführen. So teilt er die Auffassung des namhaften Bach-Forschers Hans-Joachim Schultzes:
Er schließt aus Anzahl und Art der erhaltenen Chor- und Instrumentalstimmen, dass mit rund 60 Mitwirkenden zu rechnen wäre, einschließlich ehemaliger Thomasschüler, die zur Unterstützung des herausragenden Ereignisses einer Aufführung der Matthäus-Passion zurückgekehrt sein dürften.
Gleichzeitig stellt Gardiner die Bedeutung der Passionsmusik seinerzeit klar:
Zu Bachs Zeit war in Leipzig die Aufführung der „musizierten Passion“ […] das musikalische Hauptereignis des Kirchenjahres. In der Fastenzeit konnten (da Kirchenmusik schwieg) alle Kräfte auf ihre Vorbereitung konzentriert werden.
Er greift einen Aspekt auf, dem sich Interpreten des 20. Jahrhunderts zu wenig stellen. Diesem groß angelegten epischen Werk wird man mit konzertanter Aufführung kaum gerecht, da es für den Gottesdienst und nicht für den Konzertsaal (geschweige denn für eine Aufnahme) geschrieben wurde. Die ursprüngliche Aufführungsbedingungen Bachs im Jahre 1727 oder 1736 exakt rekonstruieren zu wollen, ist illusorisch und ebenso Fiktion wie Fantasie.
Dennoch vermögen wir heute etwa der Palette orchestraler Klänge, die Bach vorschwebten, entscheidend näher zu kommen als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren.
Und hier wieder der für mich entscheidende Punkt: Gardiner erkennt aus der Partitur (der Tinte) musikalische Notwendigkeiten.
Aus einem Studium von Bachs eigenhändiger Partitur und etwa der Verwendung oder Nicht-Verwendung von Fermaten ergeben sich vielfache Hinweise auf das erforderliche dramatische Tempo in der Fügung der Sätze.
Eine konkrete Plattenempfehlung
Dem Leser wird nicht verborgen geblieben sein, dass ich persönlich die Einspielung mit den English Baroque Soloists unter Sir John Eliot Gardiner präferiere. Dabei stützt sich meine Empfehlung nicht nur auf die Auswahl der beiden erwähnten Einspielungen. Mir bekannt und von mir gänzlich gehört sind auch Einspielungen unter Rilling, Herreweghe (beide Einspielungen), Kujiken und Brook. Richter lassen wir außen vor – seine Verdienste um Bach, wenn auch nicht nach heutigen Gesichtspunkten, sind über jeden Zweifel erhaben.
Meine Empfehlung stützt sich dabei vor allem auf die gewählten Tempi und die Dynamik. Dies beginnt schon mit dem Eingangschor. Dieser ist für Richter-Fans viel zu schnell. Sie argumentieren mit dem Innehalten. Dafür bietet die Matthäus-Passion in ihrem weiteren Verlauf noch zu Genüge Gelegenheit. Diese Gelegenheiten werden von Gardiner auch zielgerichtet genutzt.
Mir geht es bei so manchem Thriller oft so, dass die Handlungsstränge an vielen Stellen die Möglichkeit böten, den Ausgang gänzlich anders zu gestalten. Aber nein, wir wissen alle, wie es ausgeht. Und dieser gleichmäßige, kraftvolle Zug beim Eingangschor, wie am Gummiband gezogen aber ohne jede Hektik, zeigt mir jedes Mal aufs Neu auf, dass wir hier einen unausweichlichen Handlungsstrang haben, den wir nicht stoppen oder beeinflussen können. Das Schicksal ist besiegelt. Raffen wir uns aus der beschaulichen Ruhe des Karfreitags auf, machen wir uns nun auf, den Herrn auf seinen letzten irdischen Wegen zu begleiten.
Die Instrumentierung und die daraus entstehenden Klangfarben sind von einer kühlen Note, wie sie nur die Barockmusik hervorbringen kann. Da ist zu keiner Sekunde etwas Romantisierendes – es fehlt aber auch zu keiner Sekunde. Die Bass-Bariton Arie „Komm, süsses Kreuz“ mit der Viola da Gamba als Soloinstrument ist in ihrer – auskomponierten, nicht romantisierend interpretierten – Schönheit, für mich einer der Höhepunkte.
Jochum vergisst in seiner Besetzung, die er mit der Barockorgel argumentiert, eine grundsätzliche Eigenschaft der Orgel im Gegensatz zu Orchester und Sängern. Der Grund, Orgelregister hinzuzuziehen oder abzustoßen, liegt ja genau im einzigen echten Nachteil der Orgel: sie hat keine Dynamik. Ein einmal gedrückter Ton spielt immer gleich laut und lässt sich nur über die Anzahl und Qualität der gezogenen Register im Ton verändern. In seiner Argumentation spricht er somit dem Orchester und den Sängern diese Variationsmöglichkeit ab.
Das ist natürlich Unsinn,
und auch in der Barockzeit standen die Sänger nicht stocksteif da und sangen einen Ton unmoduliert und immer gleich laut. Und so ist es an entsprechender Stelle durchaus sinnvoll, mit aus seiner Sicht zu wenigen Stimmen zu forcieren – so kommt allein über die nun gespanntere, griffigere Artikulation Dramatik ins Spiel. Dies geschieht nicht durch die alleinige Vergrößerung des Stimmapparates.
Was hat das mit Peter Herbolzheimer zu tun?
Hierzu eine kleine Anekdote von Peter Herbolzheimer, seines Zeichens Jazzposaunist. Er hat in beiden Orchestern gespielt: in dem von Bert Kaempfert und auch in jenem von James Last. Einmal nach dem Unterschied der beiden Bandleader gefragt antwortet Herbolzheimer: Wenn Kaempfert etwas nicht gefiel, ließ er eine Instrumentengruppe leiser spielen, bei James Last war es umgekehrt. Wer Ohren hat zu hören, der höre!
persönliche Nachbetrachtung
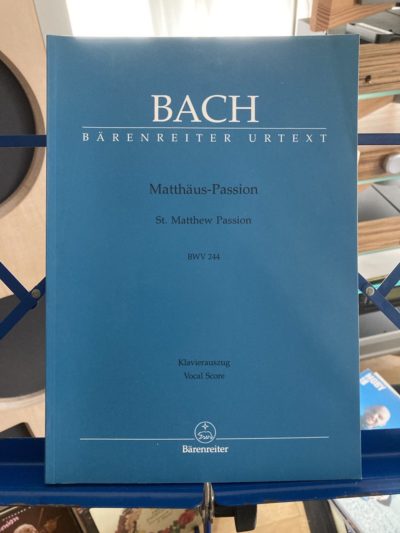
Nehmen Sie sich, am besten am Karfreitag, die Zeit und gehen Sie mit Christus den Leidensweg hörend nach. Für alle, die Noten lesen können: legen Sie sich den Bärenreiter-Klavierauszug auf die Knie!
Wieso erlaube ich mir, Bachs Matthäuspassion zu besprechen? In meiner Sturm- und Drangzeit hatte ich die Gelegenheit, das Werk unter sehr ambitionierter Leitung von Trude Klein aufzuführen. Ihr Dirigat war von äußerster Vitailtät, Beweglichkeit, Feingefühl und Freude geprägt – dabei ohne jeden portestantischen Stolz und Trotz, der leider so viele semiprofessionelle Bachaufführungen prägt und zerstört. So etwas vergisst man sein ganzes Leben nie wieder. Wie sich für mich erst später herausstellte, muss sie die Interpretation von Gardiner gekannt haben – unsere Herangehensweise hat zu einem auffallend deckungsgleichen Aufführungsstil gefunden – wenngleich natürlich nicht auf seinem Qualitätslevel.
Ich hoffe jedenfalls, dass die neun Chöre der Engel die Notenblätter der Matthäuspassion gut studiert haben und wir dereinst zusammen so Gott im Himmel rühmen können.
Das Osterlob der Kirche, das Exsultet, formuliert: O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem! (O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden!) Abgewandelt: Welch göttliches Leiden, dass uns diese Musik beschert hat!
Soli Deo Gloria!
mb
Bilder mb
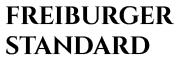

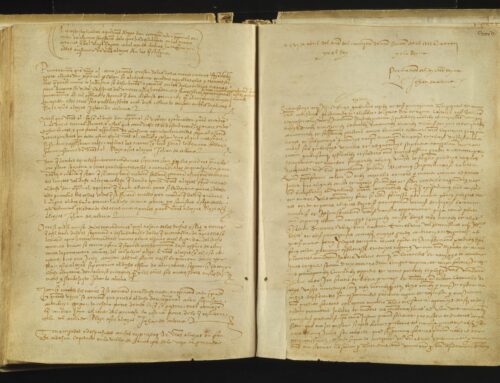


Ich bin ja was Bach und überhaupt Barock Musik angeht, ein armer Waisenknabe. Umso größer ist meine Freude und Dankbarkeit über diese schöne Einführung.